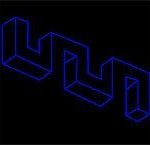Schau mir in die Augen: Wie Menschen ihr Gegenüber betrachten, hängt offenbar nicht nur von Persönlichkeitsmerkmalen ab. Auch das Geschlecht spielt eine Rolle dabei, wie nun ein Experiment enthüllt. Demnach studieren Frauen Gesichter ganz anders als Männer: Sie lassen ihren Blick viel rascher hin und her schweifen und nehmen ein größeres Spektrum des Gesichts ihres Blickpartners wahr. Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede könnten nun helfen, medizinische Methoden für die Diagnose psychischer Erkrankungen wie Autismus zu verbessern.
Der Blickkontakt mit unserem Gegenüber ist ein wichtiger Teil unserer nonverbalen Kommunikation. Wir erfassen dabei nicht nur Mimik, Gesichtszüge und Aussehen, sondern registrieren auch subtilere Hinweise auf Stimmung, Absichten, Vertrauenswürdigkeit und Persönlichkeit des anderen.
Auge in Auge nehmen wir demnach bewusst wie unbewusst eine Vielzahl von Informationen auf. Üblicherweise wechseln wir dabei immer wieder zwischen direktem Augenkontakt und dem Wiederabwenden des Blicks hin und her. Denn dauert der direkte Blickkontakt zu lange, empfinden wir das schnell als unangenehm: Nur drei Sekunden halten die meisten Menschen dieses intensive Anschauen in die Augen aus.
Blickwechsel für die Forschung
Wie wir unser Gegenüber bei diesem sozialen Blickwechselspiel betrachten und analysieren, hängt von individuellen Eigenschaften ab – aber spielt auch unser Geschlecht eine Rolle dabei? Diese Frage haben sich nun Forscher um Antoine Coutrot vom University College in London gestellt und dafür knapp 500 Freiwillige im Londoner Science Museum gebeten, sich Videoclips anzusehen.
In diesen war das Gesicht einer Person zu sehen, die die Probanden wie bei einem Videotelefonie-Gespräch ansah, zwischendurch wegschaute und dann wieder den Blick in die Kamera wandte. Während der circa 15 Minuten langen Videos trugen die Teilnehmer Eyetracker, die ihre Blickrichtung erfassten.
Frauen erkunden mehr
Bei der Auswertung zeigte sich: Tatsächlich scheinen Frauen Gesichter anders zu studieren als Männer. „Sie folgen einer weitaus explorativeren Strategie“, schreiben die Wissenschaftler. Demnach fixierten die weiblichen Probanden im Test die Augen oder andere Merkmale ihres Blickpartners kürzer, ließen ihren Blick dafür aber intensiver hin und her schweifen und richteten ihre Aufmerksamkeit auf viele verschiedene Einzelheiten des Gesichts. Kurzum: Sie erkundeten ihr Gegenüber ausführlicher – und zwar unabhängig von seinem Geschlecht.
Darüber hinaus fiel den Forschern ein weiterer Unterschied auf: Schauten die Frauen eine weibliche Person an, richteten sie ihren Blick erstaunlicherweise vermehrt auf die linke Gesichtshälfte und nutzten ihr linkes Auge mehr als das rechte.
Das Blickmuster verrät das Geschlecht
Beeindruckend: Die geschlechtsspezifischen Unterschiede waren so deutlich, dass Coutrot und seine Kollegen allein auf Grundlage des vom Eyetracker aufgezeichneten Blickmusters das Geschlecht des Probanden vorhersagen konnten – und zwar mit einer Trefferquote von 80 Prozent. „Damit zeigen wir zum ersten Mal, dass es einen deutlichen Geschlechtsunterschied beim Betrachten von Gesichtern gibt“, sagt Coutrot.
„In der Popkultur wird oft behauptet, dass Männer und Frauen die Welt auf unterschiedliche Art und Weise wahrnehmen“, ergänzt Mitautorin Isabelle Mareschal. „Nun gibt es einen Beleg dafür, dass die beiden Geschlechter visuelle Informationen wirklich anders aufnehmen.“
Relevant für Diagnosemethoden
Dass andere Faktoren wie der kulturelle Hintergrund der Probanden für diese Differenz verantwortlich sind, kann den Wissenschaftlern zufolge ausgeschlossen werden. Immerhin nahmen an dem Experiment Menschen mit rund 60 verschiedenen Nationalitäten teil. „Auch den Einfluss anderer Merkmale wie die Attraktivität oder die Vertrauenswürdigkeit des Blickpartners können wir ausschließen“, sagt Coutrot.
Die Ergebnisse könnten nun auch für die Medizin von Interesse werden. So analysieren Ärzte etwa das Verhalten beim Anblick von Gesichtern, um psychische Störungen wie Schizophrenie oder Autismus zu diagnostizieren. „Diese Blick-basierten Methoden auf eine weibliche oder eine männliche Population zuzuschneiden, könnte zu deutlichen Verbesserungen bei der Diagnose führen“, glauben die Forscher. Das sei vor allem für Erkrankungen relevant, bei denen ein Geschlecht deutlich häufiger betroffen ist als das andere: Viel mehr Männer als Frauen sind zum Beispiel Autisten. (Journal of Vision, 2016; doi: 10.1167/16.14.16)
(University of London, 29.11.2016 – DAL)