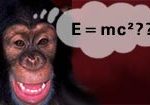Versuchskaninchen gibt es auch im Tierreich: Wenn es gilt, gefährliche Hindernisse zu überqueren, lassen ranghohe Erdmännchen-Weibchen absichtlich einem ihrer Untergebenen den Vortritt. Wie Schweizer Forscher in der Kalahari beobachten, muss dieses Versuchskaninchen dann erst das Gelände testen und für sicher befinden, bevor auch die „Chefin“ folgt. Das auf den ersten Blick egoistische Verhalten hat aber durchaus einen Sinn: Denn nur das ranghöchste Weibchen sorgt für Nachwuchs und ist daher eine für die gesamte Gruppe besonders wichtige Ressource, wie die Forscher im Fachmagazin „PLoS ONE“ berichten.
Wildtiere sind in ihrer natürlichen Umgebung zahlreichen Risiken und Gefahren wie Fressfeinden, Krankheitserregern oder Hindernissen wie Schluchten oder Wasseradern ausgesetzt. Im Laufe der Entwicklungsgeschichte haben sich deshalb spezifische Verhaltensweisen ausgebildet, mit denen Tiere die natürlichen Risiken minimieren. Nun hat der Mensch in der jüngsten Geschichte zahllose neue Gefahren und Risiken wie befahrene Straßen geschaffen. Aus evolutiver Sicht ist es ausgeschlossen, dass die Tiere diese Gefahren als potenziell tödliches Risiko kennen. Verhaltensbiologe Simon Townsend von der Universität Zürich und sein Kollege, der Systemforscher Nicolas Perony von der ETH Zürich, haben nun bei wildlebenden Erdmännchen erforscht, wie sich diese gegenüber menschengemachten Risiken verhalten.
Bei Gefahr bekommt ein anderer den Vortritt
Im Rahmen der Studie beobachtete Townsend in einem Wildtierreservat der Kalahari mehrere Erdmännchen-Gruppen. Durch das Reservat führt eine ziemlich stark befahrene Straße, welche die Territorien der lebhaften Tiere durchschneidet. Auf ihrem Weg von einem Bau zum anderen sind die Erdmännchen deshalb gezwungen, die Straße zu überqueren. Die Forscher konnten beobachten, dass in den meisten Fällen die ranghöchsten Tiere – die dominanten Weibchen – ihre Gruppen bis an die Straße führen. Dort geben sie die Führung aber häufig an ein rangtieferes Individuum ab. Das untergeordnete Tier überquert dann als eine Art „Versuchskaninchen“ die Straße als Erstes. Erst dann folgen weitere rangniedige Tiere und schließlich die Leittiere.
Auf der Basis der Beobachtungsdaten entwickelte Nicolas Perony ein relativ einfaches Computermodell, das das Verhalten der hierarchisch strukturierten Erdmännchen-Gruppe simulierte. Anhand dieses Modells vollzogen die Forscher die Umorganisation an der Spitze der Erdmännchen-Gruppe nach und konnten auch Hinweise darauf gewinnen, warum sich die Tiere so verhaltne: Offenbar nehmen dominante Weibchen und untergeordnete Tiere die Risiken, die von der Straße ausgehen, unterschiedlich stark wahr. Den Leittieren erscheint die Straße gefährlicher as den anderen Gruppenmitgliedern, deshalb lassen sie sich in eine weniger exponierte Position innerhalb der Gruppe zurückfallen und übertragen die Führung einem untergeordneten – weniger ängstlichen – Gruppenmitglied.
Verhalten ist nur scheinbar egoistisch
Durch sein hohes Risikoempfinden scheint sich das Alpha-Weibchen egoistisch zu verhalten. Aus Sicht der Gruppen- und letztlich der Arterhaltung ist das Verhalten allerdings sinnvoll. Das ranghöchste geschlechtsreife Weibchen ist nämlich für den Nachwuchs und das Fortbestehen der Gruppe alleine verantwortlich. Erdmännchen minimieren also den Schaden für die gesamten Gruppe, indem sie zuerst ein „Versuchstier“ dem lebensgefährlichen Risiko aussetzen. Beobachtungen von anderen Forschern zeigen, dass eine Erdmännchen-Gruppe auseinanderbrechen kann, wenn das Alpha-Weibchen zum Beispiel einem Fressfeind zum Opfer fällt.
Perony und Townsend deuten das Benehmen an der Straße als flexible Anpassung von alten Verhaltensweisen an bisher unbekannte Bedrohungen. Die Tiere können angeborene Verhaltensmuster offenbar abrufen und sie auf neuartige menschengemachte Risiken übertragen. Unklar ist, ob die Erdmännchen wirklich den Verkehr als Bedrohung wahrnehmen. Eine Straße sei in erster Linie ein offener Teil des Lebensraums, der den Erdmännchen keine Deckung bietet und sie dadurch für Raubfeinde wie Adler oder Schakale zu einer leichten Beute macht, sagt Townsend. Die Tiere meiden deshalb von Natur aus offene Stellen ihres Territoriums. „Sie bewegen sich lieber im Schutz von Büschen und anderen natürlichen Strukturen“, ergänzt Perony. Die Studie weckt die Hoffnung, dass Wildtiere bis zu einem gewissen Grad mit der zunehmenden Veränderung ihrer natürlichen Lebensräume zurechtkommen.
(Universität Zürich, 19.02.2013 – NPO)