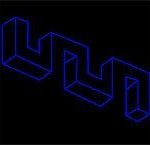Wer depressiv ist, meint häufig, alles grau in grau zu sehen. Dass dies nicht nur seelisch bedingt ist, sondern tatsächlich auf einer geringeren Kontrastempfindlichkeit der Netzhaut beruht, haben jetzt deutsche Forscher herausgefunden. In Ableitungen zeigten die Sehzellen von Depressiven dramatisch niedrigere Reaktionen auf Kontrastreize. Die jetzt im Fachjournal „Biological Psychiatry“ vorgestellte neue Methode könnte zukünftig sogar als ein zusätzliches Diagnoseverfahren eingesetzt werden.
{1l}
Depression und Melancholie werden in Kunst und Literatur schon immer mit visuellen Begriffen umschrieben: Grau und Schwarz sind die Farben, die dafür stehen. Im Englischen dagegen wird die niedergedrückte Stimmung mit der Farbe Blau in Verbindung gebracht, etwa wenn ein deprimierter Mensch sagt: „I’m feeling blue“. Dass sich hinter diesen Sprachbildern auch eine empirische Wirklichkeit versteckt, hat nun eine Arbeitsgruppe am Universitätsklinikum Freiburg in Zusammenarbeit von Psychiatrie und Psychotherapie und Augenheilkunde gefunden.
Schachbrettmuster als Test
Schon bei früheren Untersuchungen fanden die Wissenschaftler heraus, dass depressive Menschen Schwarz-Weiß-Kontraste schlechter wahrnehmen als Gesunde. In ihrer aktuellen Studie untersuchten die Freiburger mittels einer speziellen elektrophysiologischen Methode die Antwort der Netzhaut auf alternierende Schachbrettmuster mit unterschiedlichen Kontrasten bei Depressiven und Gesunden. Die Forscher leiteten dabei die Signale der Netzhaut-Sinneszellen direkt ab und konnten so objektiv deren Aktivität messen.
Sehzellen reagieren deutlich schwächer
Es zeigten sich hoch signifikante Unterschiede: Bei depressiven Menschen reagierten die Netzhautzellen tatsächlich deutlich schwächer, sichtbar an dramatisch kleineren Antwortamplituden in den Ableitungen. Sogar auf Einzelfallebene konnten die Wissenschaftler aufgrund der elektrischen Netzhautmessung depressive Menschen und Gesunde mit ungewöhnlich hoher Sensitivität und Spezifität unterscheiden.
Sollten sich diese Untersuchungsbefunde in weiteren Studien bestätigen, stünde mit dieser Methode ein Verfahren zu Verfügung, mit dem auf objektive Art und Weise der eigentlich subjektive Zustand der Depression gemessen werden könnte. Dies könnte weit reichende Auswirkungen nicht nur auf die
Depressionsforschung, sondern auch auf die Diagnose und Therapie von depressiven Zuständen haben.
(Universitätsklinikum Freiburg, 07.04.2010 – NPO)