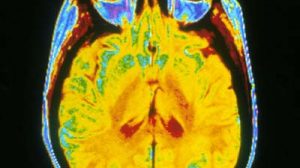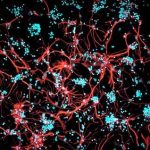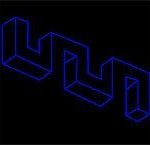Frauen erleben und verarbeiten Schmerzen nicht nur anders als Männer, sie leiden auch häufiger. Dies hat eine aktuelle Studie der Österreichischen Schmerzgesellschaft ergeben. Danach sind 28 Prozent der Österreicherinnen, aber nur 18 Prozent der Österreicher von chronischen Schmerzen betroffen.
{1l}
Obwohl sie häufiger medizinische Hilfe aufsuchen, besitzen Frauen zudem ein höheres Risiko der schmerzmedizinischen Unterversorgung. Die neuen Erkenntnisse müssten stärker in die Praxis der Schmerztherapie einfließen, fordert der Schmerzspezialist Professor Hans Georg Kress, Leiter der Abteilung für Spezielle Anästhesie und Schmerztherapie, Medizinische Universität / AKH Wien.
Dass die internationalen Aktivitäten im Rahmen der „European Week Against Pain“ in diesem Jahr unter dem Motto „Pain in Women“ stehen, hat einen guten Grund. „Wir verfügen inzwischen über immer mehr neue wissenschaftliche Erkenntnisse, dass Frauen Schmerzen nicht nur anders empfinden und verarbeiten, sondern dass es auch geschlechtsspezifische Unterschiede in der Wirksamkeit und beim Dosierungsbedarf von Schmerzmitteln gibt“, sagt Kress.
Viele Schmerzzustände bei Frauen weiter verbreitet
Schon was die Verbreitung von Schmerzzuständen betrifft, gibt es klare Unterschiede zwischen Frauen und Männern. 18 Prozent der Männer, jedoch 28 Prozent der Frauen in Österreich sind von chronischen Schmerzen betroffen, zeigt eine aktuelle Erhebung des Meinungsforschungsinstituts IMAS, die die Österreichische Schmerzgesellschaft aus Anlass der 7. Österreichischen Schmerzwochen beauftragt hat.
Bei manchen chronischen Erkrankungsbildern fällt das Verhältnis noch ungünstiger für Frauen aus, erläutert Kress neue Forschungsergebnisse. „Vom Reizdarmsyndrom zum Beispiel sind Frauen vier Mal häufiger betroffen als Männer, bei der Fibromyalgie zeigen Studien ein Verhältnis von 4:1 bis zu 7:1 auf.“ Nachgewiesen ist auch, dass Frauen häufiger als Männer an Migräne (2,5:1), Spannungskopfschmerz (1,5:1) oder chronischem Rückenschmerz (1,5:1) leiden. „Im Vergleich zu Männern haben Frauen auch öfter mehrere dieser chronischen Schmerzzustände gleichzeitig“, so Prof. Kress. „Frauen erleiden auch intensiver als Männer, und die Schmerzen dauern länger an.“
Häufiger zum Arzt – trotzdem unterbehandelt
Dazu kommt, dass Frauen Schmerzen aufgrund ein- und derselben klinischen Ursache im Lebensverlauf (Pubertät, „gebärfähiges“ Alter, Postmenopause), aber auch im Verlauf des hormonellen Monatszyklus unterschiedlich stark empfinden. „Wird dies in der Diagnostik und Therapie nicht ausreichend berücksichtigt, kann es zur Unterbehandlung kommen“, warnt Kress.
Tatsächlich ist die mangelhafte Behandlung von Frauen-Schmerzen ein verbreitetes Problem. „Frauen suchen häufiger als Männer wegen ihrer Schmerzen medizinische Hilfe. Trotzdem zeigen uns Studien, dass sie weniger intensiv behandelt werden“, sagt der Experte. „Beim Krebsschmerz zum Beispiel haben Frauen ein eineinhalb Mal größeres Risiko einer unzureichenden Schmerzbehandlung als Männer. Aber auch bei nicht-malignen Schmerzzuständen, insbesondere solchen ohne klare organische Ursache, scheint es eine Tendenz zu geben, die Intensität der Schmerzen bei Frauen zu unterschätzen oder sie einer angeblich ‚typisch weiblichen’ emotionalen Instabilität zuzuschreiben.“
Diese Unterschiede haben zum Teil einen biologischen, zum Beispiel genetischen, anatomischen oder hormonellen Hintergrund, auch pharmakokinetische und pharmakodynamische Faktoren spielen eine Rolle. Nicht übersehen werden dürften, so Prof. Kress, aber auch psychologische und sozio-kulturelle Zusammenhänge.
„Einfache, eindimensionale Erklärungsmuster für die Geschlechterunterschiede beim Schmerz gibt es nicht. Die Einsichten zu geschlechterrelevanten Unterschieden beim Schmerz werden in Zukunft viel stärker als bisher in die tägliche Praxis der Schmerztherapie einfließen müssen“, fordert der Experte. Nachholbedarf gäbe es auch in der Forschung: „In klinischen Studien zu schmerzmedizinischen Methoden und Substanzen müssen Patientinnen in Zukunft stärker vertreten sein, damit ihre spezifischen Bedürfnisse besser in die therapeutische Praxis einfließen können.“
(B&K Kommunikation, 16.10.2007 – DLO)