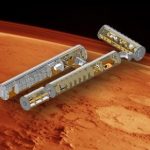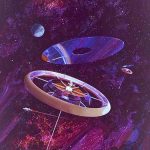Unsere Haut hat viele Aufgaben: Sie reguliert unter anderem den Wasser- und Temperaturhaushalt unseres Körpers, verhindert das Eindringen von Krankheitserregen, schützt vor UV-Strahlung und dient als Sinnesorgan. Doch wie reagiert sie auf die rauen Bedingungen des Weltraums? Dieser Frage gehen Wissenschaftler in dem vom Raumfahrtmanagement des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) geförderten Experiment „SKIN B“ nach.
Dieses ist am 28. März 2013 um 21.43 Uhr Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) zusammen mit den Astronauten der ISS-Expedition 35 an Bord einer Sojus-Rakete vom russischen Weltraumbahnhof in Baikonur zur Internationalen Raumstation gestartet und am 29. März um 03.28 Uhr MEZ an der Raumstation angekommen. Mit einer neuen Technik war die Sojus bis zur Ankunft an der ISS weniger als sechs Stunden (vier Orbits) unterwegs. Nach dem Andocken betraten die neuen Crewmitglieder bereits um 5.35 Uhr heute morgen das russische Poisk-Modul. Bislang lagen zwei Tage zwischen Launch und Ankunft an der ISS.
Nachfolger des Experiments „SkinCare“
Das Experiment SKIN B soll ab Juni im europäischen Raumlabor Columbus auf der ISS zum Einsatz kommen und den Einfluss des Weltraums auf den Zustand der Haut genauer untersuchen. Neben anderen soll der italienische ESA-Astronaut Luca Parmitano, der im Mai mit der Expedition 36 zur ISS fliegt, mit SKIN B arbeiten. Denn trockene oder schuppige Haut und Juckreiz belasten – nach Kopfschmerzen und Gleichgewichtsstörungen – die Astronauten im Weltraum besonders: „Studien der amerikanischen Weltraumbehörde NASA zeigen, dass Hautprobleme vorne auf der Rangliste gesundheitlicher Probleme im All stehen. Dazu zählen auch Verzögerungen bei der Wundheilung und allergische Reaktionen auf Materialien. Allerdings wurden diese Veränderungen bislang noch nicht systematisch untersucht“, berichtet Katrin Stang, SKIN B-Projektleiterin im DLR Raumfahrtmanagement.
Das Experiment schließt an „SkinCare“ an, das der deutsche Astronaut Thomas Reiter bei seiner Astrolab-Mission 2006 auf der Raumstation durchgeführt hat. „Es zielt darauf ab, die 2006 gemessenen Veränderungen zu bestätigen und mit mindestens drei, maximal fünf Probanden zu überprüfen“, erklärt Katrin Stang. Prof. Ulrike Heinrich von der Universität Witten-Herdecke leitet das wissenschaftliche Experiment. Sie ergänzt: „Die Haut wird dabei nicht alleine im Mittelpunkt stehen, sondern auch stellvertretend für alle mit Epithel- und Bindegewebe ausgekleideten Organe betrachtet. Denn Hautveränderungen können auch frühzeitig auf andere, systemische Krankheiten hinweisen.“