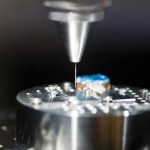Dresdner Wissenschaftlern ist es gelungen, biokompatible metallische Gläser ohne Nickel oder andere schädliche Legierungszusätze herzustellen, die sich als Material für Knochenimplantate eignen.
Knochenbrüche – ob durch Unfall oder Osteoporose verursacht – werden häufig operiert und durch eine Osteosynthese versorgt, um die Bruchstücke zusammenzuführen und zu fixieren. Dabei kommen metallische Implantate wie Platten, Drähte, Nägel oder Schrauben zum Einsatz. Als Material für solche lasttragenden Implantate sind Titanlegierungen die erste Wahl. Sie besitzen bessere Biokompatibilität als andere metallische Implantat-Materialien und ihre mechanischen Eigenschaften kommen denen des Knochens am nächsten. Wichtig ist das richtige Verhältnis zwischen hoher Festigkeit und einer niedrigen Steifigkeit. Das Material muss also sehr stabil und bruchfest, aber gleichzeitig auch elastisch sein.
Zu steif für den Knochen
Die derzeit verwendeten Legierungen für langfristig Last übertragende orthopädische Implantate haben den Nachteil, steifer als Knochen zu sein, was zur Schwächung und sogar zur Rückbildung des Knochens führen kann. Die Folge: Nach 10 bis 15 Jahren muss erneut operiert werden, um das Implantat zu ersetzen und das ist besonders problematisch für den älteren Patienten.
Deshalb wird vor allem in der Orthopädie dringend nach einem metallischen Ersatzmaterial gesucht, das sich besser mit dem Knochen verträgt. Das betrifft sowohl die mechanischen Eigenschaften als auch die chemische Zusammensetzung. Eine besonders wichtige Eigenschaft ist der niedrige Elastizitätsmodul, auch Youngscher Modul genannt, der in Giga-Pascal (GPa) gemessen wird. Er beschreibt die Steifigkeit von Material. Knochen liegen bei 10-30 GPa. Der E-Modul von herkömmlichen kommerziellen metallischen Legierungen ist mit etwa 110-120 GPa zu hoch. Ein niedriger Elastizitätsmodul des Implantat-Materials ist erwünscht, da er zu einer verbesserten Lastenverteilung zwischen Knochen und Implantat führen kann.
Mikrostrukturen mit besten Eigenschaften
Die mechanischen Eigenschaften von metallischen Materialien werden weitgehend von ihrer Mikrostruktur bestimmt, der inneren Architektur der kleinsten Bausteine. Die Arbeitsgruppe am IFW untersuchte unterschiedliche Strukturen von Titan-basierten Materialien. Neben neuen Titanlegierungen des beta-Typs erwiesen sich metallische Gläser als besonders vielversprechend. Dabei handelt es sich um Legierungen, die auf atomarer Ebene keine kristalline, sondern eine amorphe Struktur aufweisen. Ihre speziellen Eigenschaften machen sie als Implantat-Material besonders attraktiv. Bisher werden metallische Gläser in der Biomedizin aber selten verwendet, denn ihre Herstellung in massiver Form und in Zusammensetzungen mit guter biologischer Verträglichkeit ist schwierig.
Zur Glasbildung dienen herkömmlicherweise Elemente wie Nickel und Kupfer, die für den menschlichen Körper schädlich sind. Den Dresdner Wissenschaftlern ist es nun gelungen, biokompatible metallische Gläser ohne Nickel oder andere schädliche Legierungszusätze herzustellen. Zuvor untersuchten sie 27 Elemente im Hinblick auf deren biologische Verträglichkeit und deren Neigung zur Glasbildung in Titanlegierungen.
Flexibler und trotzdem bruchfest
Die neu entwickelten Legierungen bestehen aus Titan, Zirkon und Silicium, eine Variante enthält zusätzlich das Element Niob. Die Legierungen übertreffen die etablierten Materialien in entscheidenden Punkten. Sie besitzen eine weit höhere Bruch- und Verschleißfestigkeit, geringes spezifisches Gewicht und sind äußerst korrosionsbeständig sowie präzise und vielseitig zu formen. Sie sind hart wie Stahl, zugleich aber weniger steif und hoch elastisch wie Kunststoff.
Dieses Eigenschaftsspektrum prädestiniert die neu entwickelten Ti-basierten Gläser für den Einsatz in der Biomedizin. Jedoch können die amorphen Ti-Legierungen aufgrund ihrer geringen Glasbildungsfähigkeit bis jetzt nicht in Form von Platten oder Nägeln hergestellt werden. Sie sind eher als verschleiß- und korrosionsbeständige Beschichtungen von metallischen Implantaten interessant. Weitere Experimente sind erforderlich, die zur Verbesserung der Glasbildungsfähigkeit der Ni-freien Ti-basierten metallische Gläser führen sollten.
Für die Veröffentlichung dieser Arbeit wurde das IFW Forschungsteam 2016 mit einem Preis des Editors-in-Chief des wissenschaftlichen Journals Materials Science & Engineering C: Materials for Biological Applications ausgezeichnet. Die Forschungsergebnisse können als Grundlage dienen für die zukünftige Gestaltung von amorphen Titanlegierungen für Implantate, insbesondere für Osteosynthese-Systeme.
Dem Knochen sehr ähnlich
Dass sich durch den Zusatz anderer biokompatiblen Elemente die mechanischen Eigenschaften von Titan gezielt manipulieren lassen, zeigt eine weitere Neuentwicklung der Forscher am IFW Dresden. Mit dem Ziel, die Steifigkeit des Materials zu reduzieren, untersuchten sie verschiedene Beta-Typ-Legierungen auf Titan-Niob-Basis. In abhängig von der Zusammensetzung und Prozessierung kann diese Legierungsklasse niedrige E-Module, erhöhte Festigkeit, sowie Superelastizität oder Formgedächtniseffekt aufweisen. Durch Zugabe von Indium (bis zu 5 mass %) gelang es, den Elastizitätsmodul auf etwa 50 GPa zu senken. Auch der Zusatz von Zinn hatte diese Wirkung. Diese Werte nähern sich stark an die Steifigkeit des Knochens an. Obendrein sind Niob und Indium unschädlich für den Körper. Die derzeit in der Orthopädie verwendete Titanlegierung enthält Aluminium und Vanadium. Nach neuen Studien könnten sie toxische Effekte erzielen oder neurodegenerativen Erkrankungen verursachen.
Neben den biomechanischen Eigenschaften steht die Modifizierung der Materialoberfläche im Fokus der Wissenschaftler. Denn die Nanostruktur der Oberfläche ist mit entscheidend für die optimale Wechselwirkung mit dem Knochengewebe und eine hohe Implantat-Lebensdauer. Untersucht werden außerdem Shape Memory Effects der neuen Legierungen. Werkstoffe mit einem „Formgedächtnis“ lassen sich – etwa durch eine Temperaturveränderung – zurück in die ursprüngliche Form bringen. Beta-Titan besitzt dieses Potenzial und zählt damit zu den „Smart Materials“. Das macht es auch für andere Anwendungen wie für Stents in der Kardiologie oder für Zahnprothesen interessant.
(Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden, 19.09.2016 – NPO)