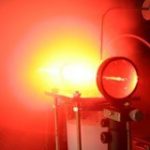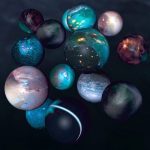Wissenschaftlern der Universität Heidelberg ist es gelungen, nicht nur die Stärke, sondern auch die Natur der Wechselwirkung zwischen mikroskopischen Quanten-Magneten – den sogenannten Spins – gezielt zu verändern. Anstatt in einen Zustand vollständiger Unordnung zu verfallen, können die speziell präparierten Magnete ihre ursprüngliche Ausrichtung über einen langen Zeitraum aufrechterhalten. Damit haben die Heidelberger Physiker erfolgreich eine programmierbare Kontrolle der Wechselwirkung in isolierten Quantensystemen demonstriert.
Die Kräfte zwischen Teilchen, Atomen, Molekülen oder sogar makroskopischen Objekten wie Magneten sind durch die Wechselwirkungen der Natur festgelegt. So richten sich zum Beispiel zwei nahe beieinanderliegende Stabmagnete unter der Wirkung magnetischer Kräfte neu aus. Einem Team um Prof. Dr. Matthias Weidemüller und Dr. Gerhard Zürn am Zentrum für Quantendynamik der Universität Heidelberg ist es nun gelungen, nicht nur die Stärke, sondern auch die Art der Wechselwirkung zwischen mikroskopischen Quanten-Magneten – den sogenannten Spins – gezielt zu verändern. Anstatt in einen Zustand vollständiger Unordnung zu verfallen, können die speziell präparierten Magnete ihre ursprüngliche Ausrichtung über einen langen Zeitraum aufrechterhalten. Damit haben die Heidelberger Physiker erfolgreich eine programmierbare Kontrolle der Wechselwirkung in isolierten Quantensystemen demonstriert.
Magnetische Systeme können überraschendes Verhalten zeigen, wenn sie in einer instabilen Konfiguration präpariert werden. Wird beispielsweise eine Ansammlung räumlich ungeordneter magnetischer Dipole, wie etwa Stabmagnete, in dieselbe Richtung eingestellt, führt dies zu einer anschließenden Neuausrichtung der Magnete. Diese Dynamik mündet schließlich in eine Gleichgewichtskonfiguration, bei der alle Magnete zufällig ausgerichtet sind. Während sich in der Vergangenheit die meisten Untersuchungen auf klassische magnetische Dipole beschränkten, ist es seit kurzem möglich, die Ansätze mit Hilfe sogenannter Quantensimulatoren auf Quanten-Magnete auszuweiten: Synthetische atomare Systeme ahmen die grundlegende Physik magnetischer Phänomene in einer extrem gut kontrollierten Umgebung nach, in der alle relevanten Parameter nahezu nach Belieben eingestellt werden können.
Für ihre Quantensimulationsexperimente verwendeten die Forscher ein Gas aus Atomen, das auf eine Temperatur nahe dem absoluten Nullpunkt abgekühlt wurde. Mithilfe von Laserlicht wurden die Atome in extrem hohe elektronische Zustände angeregt, die das Elektron um nahezu makroskopische Abstände vom Atomkern trennen. Diese „atomaren Riesen“, auch Rydberg-Atome genannt, stehen in Wechselwirkung über Distanzen von fast Haaresbreite miteinander. „Ein Ensemble von Rydberg-Atomen weist genau die gleichen Eigenschaften auf wie wechselwirkende ungeordnete Quanten-Magnete, was es zu einer idealen Plattform für die Simulation und Erforschung des Quantenmagnetismus macht“, sagt Dr. Nithiwadee Thaicharoen, die als Postdoktorandin in Prof. Weidemüllers Team am Physikalischen Institut tätig war und mittlerweile als Professorin in Thailand forscht.