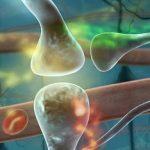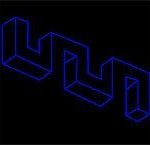Eine durchaus häufige Form der Halluzination tritt nicht nur bei geistig völlig Gesunden auf, sie erfordert auch keinerlei emotionale oder sonstwie psychische Extremsituation. Einzige Voraussetzung: eine mangelnde Stimulierung der Sinne.
Fünf Tage mit Augenbinde
Im Jahr 2004 führten Lofti Merabet und seine Kollegen von der Harvard University dazu ein wegweisendes Experiment durch: 13 Freiwillige trugen fünf Tage lang ununterbrochen eine Augenbinde, die sie völlig blind machte. Die Probanden durften Radio und Fernsehen hören, bekamen zu essen, durften sich unterhalten und sich ganz normal bewegen, sogar nach draußen gehen. Nur ihr Sehsinn war ausgeschaltet.
Schon nach einem Tag beschrieben zehn der 13 Teilnehmer Ungewöhnliches: „Sie erlebten visuelle Halluzinationen, von denen einige nur aus hellen Lichtflecken bestanden. Andere waren dagegen komplexer und bestanden aus Gesichtern, Landschaften oder verzierten Objekten“, berichten die Forscher. Typischerweise erschienen diese Trugbilder ganz abrupt und hielten einige Sekunden oder Minuten an, um dann wieder genauso plötzlich zu verschwinden.
Häftlings-Kino und Hippie-Visionen
Diese Erfahrungen demonstrieren, dass unser Gehirn schon bei relativ kurzzeitigem Entzug von Sinnesreizen mit Halluzinationen reagieren kann. Gleichsam zur Kompensation der visuellen Reizarmut schafft sich das Gehirn seine optischen Eindrücke selbst. Solche Halluzinationen durch Reizentzug wurden schon früher auch bei Gefangenen beobachtet, wenn diese in Dunkelheit und Einzelhaft saßen – als „Prisoner’s Cinema“ wurde dies eher zynisch bezeichnet.

Eher positiv sah man diese Form der Halluzinationen dagegen in den späten 1960er Jahren: Auf dem Höhepunkt der Hippie-Ära sah man sie als Ausdruck eines erweiterten Bewusstseins. In speziellen Isolationstanks schwebend, versuchte man diese Halluzinationen absichtlich herbeizuführen. Das warme Wasser, die Dunkelheit und manchmal auch entsprechend psychedelische Musik sollten zu ganz neuen, tiefgreifenden Visionen und Erkenntnissen über das Selbst und das Universum führen – so jedenfalls hoffte man.
Das Charles Bonnet Syndrom
Dier Entzug von Sinnesreizen erklärt auch, warum erblindete oder ertaubte Menschen unter Halluzinationen leiden können. Ein typisches Beispiel dafür ist das Charles Bonnet Syndrom, benannt nach seinem Entdecker, einem Schweizer Naturforscher des 18. Jahrhunderts. Typischerweise tritt es bei älteren Menschen auf, die beispielsweise durch den Grauen Star oder eine Makuladegeneration ihre Sehfähigkeit ganz oder teilweise einbüßen.
In Reaktion darauf produziert das Gehirn einiger Betroffener visuelle Halluzinationen – die Spannbreite reicht dabei von einfachen geometrischen Mustern bis zu elaborierten, filmartigen Szenen. Hirnscans enthüllen dabei eine verblüffende Übereinstimmung zwischen den optischen Trugbildern und der Hirnaktivität, wie der Neurologe Oliver Sacks berichtet: „Halluzinationen von Gesichtern, Farben, Texturen oder Objekten aktiveren jeweils die spezifischen Hirnareale, die auch normalerweise an der Wahrnehmung dieser Dinge beteiligt sind“, erklärt er.

Monster und Mythen
Aber längst nicht immer ist die Störung oder Blockade eines Sinnes nötig, um Halluzinationen hervorzurufen, wie Sacks erklärt: „Visuelle Monotonie kann fast die gleiche Wirkung haben.“ Nicht zufällig berichteten früher Seeleute nach langen Fahrten über das offene, ruhige Meer häufig von seltsamen Erscheinungen. Es wäre nicht verwunderlich, wenn viele Legenden über Seemonster und Geisterschiffe in solchen Halluzinationen ihren Ursprung haben.
„Kurz nach dem zweiten Weltkrieg wurden solche Visionen auch als Risiko für Piloten erkannt, die über Stunden in großer Höhe durch einen leeren Himmel fliegen“, berichtet Sacks. „Auch Trucker, die auf langen Strecken stundenlang auf eine endlose Straße starren, können solche Halluzinationen erleben.“
Diese Beispiele demonstrieren sehr gut, dass Halluzinationen keineswegs „verrückt“ oder krankhaft sein müssen. Stattdessen sind sie oft einfach ein Ausdruck der Anpassungsfähigkeit und des faszinierenden Eigenlebens unseres Gehirns.
Nadja Podbregar
Stand: 24.02.2017