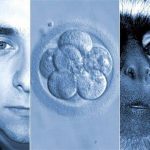Klonschaf Dolly, das erste geklonte Säugetier in den 1990er-Jahren, ging nicht auf das Konto von Embryologen. Es waren Agrarwissenschaftler, die sich der 30 Jahre alten Technik bedienten – mit der Absicht, sie landwirtschaftlich anzuwenden und tatsächlich gleiche Individuen besonders erfolgreicher Nutztiere herzustellen oder die Klontechnik als Werkzeug für die Herstellung gentechnisch veränderter Organismen zu benutzen.
Nicht gradlinig
Die Geschichte des Klonens ist für die Wissenschaftsgeschichte in vielerlei Hinsicht typisch, erläutert die Wissenschaftshistorikerin Christina Brandt. „Die Entstehung von Wissen ist äußerst lokal, weil das Know-how bei einzelnen Forschern oder Arbeitsgruppen liegt und teure Großgeräte nur an wenigen Orten verfügbar sind“, sagt die Forscherin. „Die Fortentwicklung wird dann häufig durch das Überschreiten von Disziplinengrenzen begünstigt, und sie ist keinesfalls geradlinig.“
Die Dynamik des Forschungsprozesses wird ihrer Erfahrung nach durch das Changieren von wissenschaftlicher Neugier und technischer Anwendung vorangetrieben. „Die Visionäre in Sachen Klonen waren eben nicht die Embryologen, die die Technik entwickelt hatten“, so Brandt.

„Vollkommen unvorhersehbar“
Typisch ist auch, dass mit großem zeitlichem Abstand vorhandene Techniken für die Anwendung wieder aufgegriffen werden. Manche Forschungszweige werden zu bestimmten Zeiten als regelrecht esoterisch angesehen, erleben dann aber plötzlich einen Boom. „Die Entstehung von neuem Wissen ist oft vollkommen unvorhersehbar. Das ist natürlich auch ein ethisches Problem. Man kann nie wissen, wofür etwas, das jemand zu einem bestimmten Zweck entwickelt, einmal genutzt werden wird“, so Brandt.