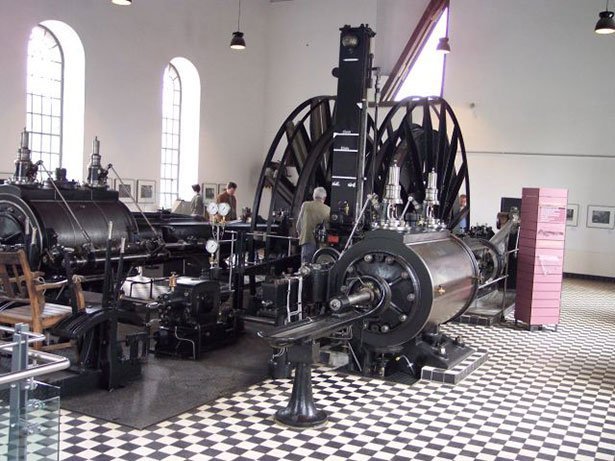Dass es im Ruhrgebiet reichlich Steinkohle gibt, verdankt die Region den geologischen und klimatischen Ereignissen in der Karbonzeit, vor rund 300 Millionen Jahren. Damals lag Deutschland noch am Äquator, das Ruhrgebiet war ein von Sümpfen, Sandbänken und Wasserläufen durchsetztes Schwemmland unweit der Meeresküste.

Vom Baum zur Kohle
In diesen Sumpfgebieten entwickelte sich eine üppige Vegetation, darunter Farne, Schachtelhalme und die sich erst an ihrem Wipfel verzweigenden Cordaiten – Verwandte unserer heutigen Nadenbäume. Weil sich die Flussläufe immer wieder verlagerten, aber auch der Meeresspiegel wiederholt anstieg und wieder absank, wurden diese Sümpfe periodisch überflutet und mit Sand oder Ton überdeckt.
Im Laufe der folgenden Jahrmillionen wurden diese vergrabenen Schichten immer größerem Druck und Wärme ausgesetzt. Dadurch wandelten sich die abgestorbenen Pflanzenreste und der Humus zuerst zu Braunkohle, dann zu Steinkohle. Eine ursprünglich acht Meter dicke Torfschicht, die sich in rund 8.000 Jahre des Pflanzenwachstums angesammelte hatte, verdichtete sich dabei zu einer nur noch einen Meter mächtigen Kohlenschicht.
Durch die Wechselwirkung von Tektonik und Erosion wurden die Kohleschichten unter dem Ruhrgebiet im Laufe der Zeit gekippt und angehoben. Sie bilden eine gewaltige schiefe Ebene, die von Süden nach Norden hin abfällt.