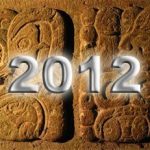Herr X, als Migränepatient in homöopathischer Behandlung, hat durchaus gute Chancen, seine Kopfschmerzen loszuwerden. Die fünf Globuli, die er brav dreimal täglich einnimmt, haben damit allerdings nach Ansicht der meisten Wissenschaftler überhaupt nichts zu tun. Denn das, was hier wirkt, ist nichts anderes als der Placeboeffekt.

Scheinbehandlung hemmt Schmerz – auch im Rückenmark
Placebo, abgeleitet vom lateinischen „ich werde gefallen“, bezeichnet ein Wirkstoff-freies Scheinarzneimittel, aber auch eine Scheinbehandlung. Seit langem ist bekannt, dass dieses bei Menschen medizinisch messbare Wirkungen auslösen kann. So erlebten 82 Prozent der Patienten, die Mitte der 1990er Jahre statt des Schmerzmittels Naproxen unwissentlich ein Placebo erhalten hatten, eine deutliche Schmerzlinderung. Die Wirkung des Placebos geht dabei weit über das subjektive Erleben hinaus, wie Mediziner des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf 2009 in „Science“ nachgewiesen haben: Patienten, die in dieser Studie ein Scheinschmerzmittel erhalten hatten, spürten nicht nur keinen Schmerz, auch die Aktivität der schmerzleitenden Nervenzellen in ihrem Rückenmark war deutlich reduziert.
Erwartung beeinflusst Reaktion
Welchen Einfluss dabei die Erwartungen des Behandelten haben, ob bewusst oder unbewusst, zeigte unter anderem eine bereits 1970 an Asthmatikern in New York durchgeführte Studie. Die Ärzte verabreichten den Versuchspersonen entweder Isoproterenol, ein die Bronchien erweiterndes Medikament, oder Carbachol, ein verengendes und damit die Atemnot verschlimmerndes. Jeweils die Hälfte der Patientengruppe wurde jedoch über die wahre Behandlung getäuscht, die Ärzte erzählten ihnen, sie hätten das genau gegenteilige Mittel bekommen. Das Erstaunliche daran: Die Asthmatiker, die das Bronchien verengende Carbachol als vemeintliches Isoproterenol erhalten hatten, fühlten sich nicht nur subjektiv wohler, Messungen des Lungenvolumens und des Luftstroms bestätigten dies auch.
Dass der Placeboeffekt sogar bei Kleinkindern und Tieren wirkt, haben ebenfalls einige Studien belegt. Nach Ansicht der Wissenschaftler könnte dies beispielsweise dadurch erklärt werden, dass sich die positive Erwartungshaltung der Eltern oder des Tierhalters nonverbal überträgt. Gleichzeitig wirkt sich vermutlich auch eine erhöhte Zuwendung und Aufmerksamkeit positiv aus.