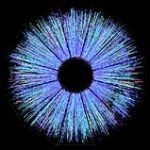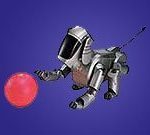Gel, das rechnen kann, eine Molekülbrühe, die komplexe Algorithmen löst und dünne Farbschichten, die Informationen weiterleiten und verarbeiten – nach Ansicht vieler Wissenschaftler könnten so die Computer der Zukunft aussehen. Biocomputer statt Siliziumchips, „Wetware“ statt Hardware – an die Stelle von Chips, Transistoren und Platinen träten dann DNA, Bacteriorhodopsin und andere Biomoleküle. Leitungsbahnen würden durch chemische oder biologische Interaktion zwischen den Molekülen ersetzt.
Reine Zukunftsmusik? Nicht für Forscher wie Leonard Adleman von der Universität von Südkalifornien in Los Angeles, Bob Birge vom Keck Center für molekulare Elektronik in Syracuse oder Tim Gardner von der Firma Cellicon Biotechnologies in Boston. Sie und viele andere Computerwissenschaftler weltweit arbeiten bereits seit Jahren daran, funktionierende Biocomputer zu entwickeln. Auf jeweils unterschiedliche Weise bedienen sich die Forscher dabei der Ressourcen der Natur, um die Grenzen der heutigen Computertechnik zu überwinden.
„Jede lebende Zelle enthält tausende von unglaublich kleinen, erstaunlich präzisen Instrumenten in Form von Molekülen als eine Art „Werkzeugkasten der Natur““, erklärt Leonard Adleman. „Ich glaube, dass es zu einer „molekularen Revolution“ kommen wird, die dramatische Auswirkungen für die gesamte Welt haben könnte, wenn wir es lernen, diese Werkzeuge zu gebrauchen.“
Gegenüber herkömmlichen technischen Bauteilen haben Biomoleküle gleich mehrere Vorteile: Die Produktion der Grundbausteine ist meist günstig, entweder sie vermehren sich selbst oder sie können durch relativ einfache chemische und biotechnische Verfahren hergestellt werden. Und sie sind klein – sehr klein. Schon ein Gramm DNA enthält mehr Information als eine Million CDs und eine DNA-Menge von der Größe einer Träne könnte die schnellsten Supercomputer der heutigen Zeit an Rechenleistung um ein Vielfaches übertreffen.