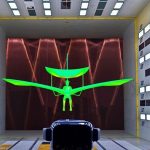Schon kommt der Fernsehturm in Sicht, lange kann es nicht mehr dauern. Unten auf der Bundesstraße 433 währenddessen: Unfall, Stau, Bildung einer Rettungsgasse für Einsatzfahrzeuge. Wenig später wechseln die sechs schwenkbaren Rotoren des Lufttaxis in den Landemodus, der vertikale Abstieg über der Binnenalster wird autonom eingeleitet.

Zwei Herausforderungen
Das Lufttaxi der Zukunft sollte sicher, zuverlässig und weitestgehend autonom sein – so das Ziel. Wie es gelingen kann, solche Vehikel sicher aus der Ferne zu betreiben und zu überwachen und wie die Zertifizierung für diese Fluggeräte ablaufen müsste, haben die Forschenden im Projekt HorizonUAM ebenfalls untersucht.
Es zeigte sich schnell, dass bei Lufttaxis zwei große Herausforderungen der bemannten und unbemannten Luftfahrt zusammenkommen: der Wunsch nach vergleichbarer Autonomie wie in der unbemannten Luftfahrt und nach gleich hohen Sicherheitsstandards wie in der bemannten Luftfahrt. „Die Zertifizierbarkeit von Lufttaxi-Komponenten, wie zum Beispiel des Batteriesystems, konnten wir erfolgreich nachweisen. Für die deutlich komplexere Zertifizierung von Autonomiefunktionen haben wir Teillösungen erarbeitet, hier besteht aber weiterhin Forschungsbedarf“, erläutert Projektleiterin Bianca Schuchardt.
1:4-Stadtmodell als Testfeld
Zukünftig sollen Flüge von Drohnen und Lufttaxis außerhalb der Kontrollzone von Flughäfen über das System „U-space“ ohne Beteiligung von Lotsinnen oder Lotsen koordiniert werden. Damit der Betrieb über dicht besiedeltem Gebiet dennoch sicher ist, müssen Flugtaxis untereinander zuverlässig und in Echtzeit kommunizieren, um nicht zu kollidieren. Das DLR-Team entwickelte dafür ein Ad-hoc-Kommunikationssystem, das auf die speziellen Anforderungen des städtischen Luftverkehrs zugeschnitten ist.