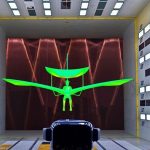Der CO2-Ausstoß von Autos und LKWs ist in der heutigen Zeit ein wichtiger Faktor in der ökologischen und damit auch politischen Debatte. Neben alternativen Antriebsmöglichkeiten und effizienteren Motoren haben die Automobilhersteller über die vergangenen Jahrzehnte auch an der Aerodynamik ihrer Modelle gefeilt, um durch weniger Spritverbrauch auch weniger Treibhausgase auszustoßen.

Außerorts dominiert der Luftwiderstand
Während innerorts und bei geringen Geschwindigkeiten noch die Trägheit und der Rollwiderstand die größten Hemmfaktoren eines Autos sind, hat der Luftwiderstand ab 60 Kilometern pro Stunde aufwärts die größte Bedeutung. Auf der Autobahn stammen immerhin 70 Prozent des gesamten Fahrwiderstandes aus dem Luftwiderstand. Diesen zu minimieren, ist also entscheidend, wenn man effizient höhere Geschwindigkeiten erreichen will.
Wie viel Widerstand die Luft einem sich bewegenden Fahrzeug entgegensetzt, errechnet sich aus der Dichte der Luft, der Geschwindigkeit, der Stirnfläche und dem Widerstandsbeiwert cW. Letzterer setzt sich aus der Luftreibung am Fahrzeug und dem direkten Widerstand durch senkrecht zur Fahrtrichtung stehende Flächen zusammen. Der Widerstandsbeiwert wird oft als Kenngröße für den Luftwiderstand eines Autos gesehen.
Durch Design gesunken
Zu Beginn der Automobilentwicklung, als die Fahrzeuge noch sehr den damaligen Kutschen ähnelte, lag ihr cw-Wert dieser zwischen 0,8 und 1. Nach dem zweiten Weltkrieg verbreitete sich dann die „Ponton“-Karosserie, die erstmals ein Stufenheck mit Kofferraum besaß. Zusätzlich waren die Kotflügel und Scheinwerfer nicht mehr freistehend, sondern in die Karosserie integriert. Durch diese Bauform konnte der cW-Wert auf knapp über 0,5 gesenkt werden.