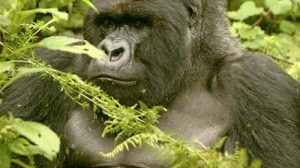Die steigende Bedarf an Coltan führte zu Beginn des neuen Jahrtausends nicht nur dazu, dass zahlreiche große internationale Industrieunternehmen in den Abbau und den Handel einstiegen – auch außerhalb von Zentralafrika wurden Vorkommen entdeckt, in Südamerika, Australien und Kanada, deren Abbau sich lohnte.
Soziale Folgen des Coltan-Booms
Doch da in Zentralafrika die weitaus größten Reserven des begehrten Erzes lagern, brachte hier der Coltan-Boom auch die größten sozialen Veränderungen mit sich. Zu dieser Erkenntnis kommt eine gemeinsame Studie der kongolesischen Entwicklungshilfe-Organisation Pole-Institut, des Deutschen Evangelischen Entwicklungsdienstes und der deutschen Tageszeitung taz.
Zur Zeit des großen Coltan-Booms Ende 2000 bis August 2001, als die Weltmarktpreise bereits wieder zu fallen begannen, untersuchten die Entwicklungshelfer insbesondere die Gegend um Masisi, im Osten der Demokratischen Republik Kongo, in der die Menschen traditionell von Landwirtschaft leben, und die Gegend um die Coltan-Minen von Numbi.
Wilder Bergbau
Anders als in den Industrieländern Kanada oder Australien, wo Abbaulizenzen vergeben werden und der Abbau selbst industriell erfolgt, erhofften sich durch den kleingliedrigen Abbau im Kongo oder in Ruanda auch einfache Leute, finanziell vom Coltan-Rausch zu profitieren. Hatten sie doch die Hoffnung, sich aus ihrer oft ärmlichen Lebenssituation zu befreien. In dem durch den Bürgerkrieg entstandenen wirtschaftlichen und politischen Vakuum gab es zudem kein staatlich reguliertes Abbausystem. Jeder der wollte, konnte anfangen zu graben. Professionelle Händler vermittelten den Verkauf des abgebauten Coltans und drückten den Lohn oft zu ungunsten der Bergleute, während die Preise auf dem Weltmarkt stiegen.