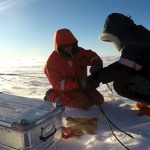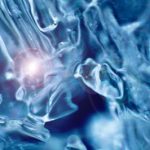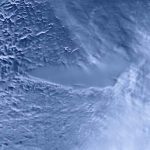Der Antarktisvertrag bewahrte die Antarktis nicht nur vor einer Aufteilung in unzählige nationale Territorien, sondern beinhaltete gleichzeitig auch Richtlinien für den Erhalt der einmaligen Flora und Fauna des antarktischen Gebiets. In einem speziellen Anhang einigten sich die Vertragsstaaten auf folgende Vorgaben:
Innerhalb der Antarktis ist es verboten, einheimische Vögel oder Säuger zu töten, zu verwunden, zu fangen oder sonst wie zu schädigen. Ausnahmen sind nur mit Sondergenehmigung möglich. Die Lebensräume von Vögeln und Säugern sind geschützt. Störungen in Brut- oder Aufzuchtperioden soll minimiert werden. Besonders geschützt sind Pelzrobben- und Ross-Seehunde. Gebiete mit herausragender Bedeutung für Natur und Wissenschaft dürfen nur mit Erlaubnis betreten werden. Sie sind streng geschützt. Es dürfen keinerlei Tier- oder Pflanzenarten in die Antarktis eingeführt werden, die dort nicht heimisch sind. Vorsichtsmaßnahmen sollen sicherstellen, dass keine Parasiten oder Krankheiten eingeschleppt werden.
Nur halb geschützt

Diese Schutzbestimmungen trugen immerhin dazu bei, wenigstens die Tierwelt des antarktischen Festlands weitestgehend zu schützen. Kaum effektiv waren die Regeln allerdings in Bezug auf das Südpolarmeer. Mit dem Schwinden der reichen Fischbestände in überfischteren Gewässern drängten immer mehr Fangflotten in die antarktischen Meere, Wale, Thunfische und andere Meerestiere wurden gejagt statt geschützt.
Ähnlich ineffektiv waren die Vorgaben auch für den Umweltschutz: Mit zunehmender Zahl von wissenschaftlichen Stationen und Forschungsaktivitäten, nahm die Verschmutzung des Eises mit Abfällen, Schrott, Fäkalien und Öl- und Benzinrückständen zu. Da unter den kalten Temperaturen kein biologischer Abbau stattfindet, bleibt alles – auch die Abfälle – für die Ewigkeit erhalten.