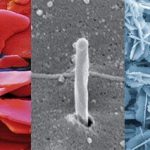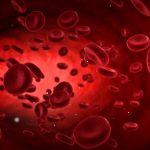Künftig soll jährlich ein Tank mit neuen Humanproben hinzukommen, gesammelt mit dem Hightech-Labor-Truck. Sein Kernstück ist ein 40 Quadratmeter großer Bereich im Laderaum. Er lässt sich schaffen, indem der Auflieger des Sattelschleppers seitlich ausgefahren wird. Dadurch wächst die Ladefläche auf das Doppelte. Etwa die Hälfte des Raums füllt das Labor. Die andere Hälfte bietet Platz für drei Arztarbeitsplätze.
Während die Proben gesammelt werden, nimmt eine Zahnärztin das Gebiss der Testpersonen unter die Lupe, um festzuhalten, ob es Zahnfüllungen gibt. So lässt sich später ermitteln, ob Quecksilber-Belastungen im Urin mit amalgamhaltigen Zahnfüllungen korrelieren oder mit einem erhöhten Fischkonsum. Danach geht es für die Studierenden, die sich freiwillig gemeldet haben, weiter zum Blutabnehmen. Am Ende haben zwei Ärztinnen insgesamt 145 Milliliter Blut gewonnen.
Gleiche Bedingungen – überall
„Der Truck verändert die Qualität der medizinischen Probenahmen entscheidend“, sagt Daniel Schmitt. „Denn er stellt erstmals ein identisches Labor an allen Standorten bereit.“ Überall und jederzeit lassen sich nun Proben auf dieselbe Weise und unter gleichen Bedingungen sammeln und verarbeiten. Bisher mussten die Forscher meist improvisieren und waren für ihre Arbeit auf wechselnde Labors und anderweitig genutzte Räume angewiesen. „Unterschiedliche Voraussetzungen an den Probenahme-Standorten führen automatisch zu verschiedenen Prozessen, was eine übergreifende Standardisierung der Arbeitsabläufe in allen Labors sehr schwierig macht“, sagt Dominik Lermen.
Die Urinproben brachten die Studierenden selbst mit zum Arzttermin im Truck. Zusammen mit der Probe gaben sie einen ausgefüllten Fragebogen bei den Forschern ab. Gefragt wurde unter anderem nach den Materialien von Bodenbelägen und Leitungen in der Wohnung, nach Ernährungsgewohnheiten, Erkrankungen und regelmäßig eingenommenen Medikamenten. „Die Antworten liefern uns ein Bild von den Lebensumständen der Testpersonen“, sagt Dominik Lermen. „Sie lassen etwa darauf schließen, ob Spuren von Blei oder Kupfer aus Wasserrohren stammen oder ob ein hoher Gehalt an Schwermetallen von bestimmten Speisen verursacht wurde.“ Um die Quelle von Umweltbelastungen lokalisieren zu können, registrierten die Forscher zudem, wo die Testpersonen aufgewachsen waren und wo sie sonst gewohnt haben.