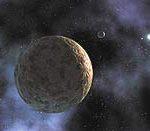Am 12. Februar 1961 schauten sowjetische Ingenieure, Wissenschaftler und Ehrengäste einer Rakete nach, die langsam im Himmel entschwand. An ihrer Spitze: Venera 1, die erste Raumsonde der Menschheit, die zu einem anderen Planeten gestartet werden sollte. Das Ziel war die Venus, versteht sich. Nach einigen Minuten wurde die rund 640 Kilogramm schwere Sonde von der obersten Raketenstufe, Sputnik 8, im Erdorbit getrennt und Richtung Venus geschossen.
Nun war es also so weit. Nach Jahrhunderten des Rätselns war die erste von Menschen gebaute Maschine auf der Reise zwischen den beiden Schwesternwelten. Die Sowjets begannen damit das bis heute umfangreichste Planetenforschungsprogramm, das je unternommen wurde. Nicht Mars, nicht Jupiter, nein, der Venus galt die längste Anstrengung der Raumfahrtgeschichte.
Allein, Venera 1 war ein bisschen ein Rohrkrepierer. Am 17. Februar konnte man zum letzten Mal Kontakt mit dem kleinen Botschafter herstellen und ein paar wissenschaftliche Daten übertragen. Dann war Stille. Trotzdem glaubt man heute, dass Venera 1 pflichtbewusst in einem Abstand von 100.000 Kilometern an Venus vorbeigeflogen ist.
Gescheiterte Bemühungen
Viele Sonden folgten, Venera 3 zum Beispiel, der erste Versuch einer Landung. Die Geschichte von Venera 3 ist ein faszinierendes Beispiel für die Enthüllung der wahren Venus. Am Anfang steht ein aus heutiger Sicht rührendes Design der Landeeinheit: Die sowjetischen Konstrukteure, Meister ihres Fachs damals wie heute, bereiteten den ersten Botschafter der Menschheit so vor, dass er einen Druck von bis zu fünf Atmosphären überstehen konnte sowie eine Temperatur zwischen 57 und 77 Grad Celsius. Er hatte Solarzellen zur Energiegewinnung an Bord und ein Ammoniak-Kühlsystem, beides für die Arbeit auf der Venusoberfläche. Und tatsächlich: Die Landeeinheit war dafür konstruiert, im Wasser zu schwimmen und Wellenbewegungen festzustellen.