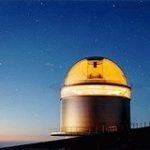Alle Energie, die das Weltraumteleskop für seine Instrumente, seine Ausrichtung und das Senden seiner Daten benötigt, bezieht es von seinen Solarsegeln. Sie laden auch die Batterien auf, mit denen die Instrumente beim Flug durch die Nachtseite der Erde versorgt werden. Doch diese Segel so zu konstruieren, dass sie sowohl den harschen Bedingungen des niedrigen Erdorbits standhalten, als auch überhaupt dorthin gelangen, war alles andere als einfach.

Eingerollt statt ausgeklappt
Die meisten normalen Satelliten besitzen starre Sonnensegel, die maximal wie eine Art Ziehharmonika gefaltet werden können. Doch mit solchen Segeln hätte das rund vier Meter dicke und gut 13 Meter lange Hubble nicht in das Space Shuttle gepasst – es blieb schlicht zu wenig Platz. „Die Segel mussten daher flexibel sein, damit sie zwischen die runde Hülle des Teleskops und die runden Wände der Ladebucht passten“, erklärt Lothar Gerlach, ESA Projektmanager für das Solarsystem von Hubble.
Um das zu gewährleisten, entwickelten die Ingenieure von NASA und ESA für Hubble einrollbare Solarsegel – wie ein Art Rollo, das mit Solarzellen beschichtet ist. Beim Transport des Teleskops war diese mehrschichtige Folie in einer eigenen Schutzhülle eingerollt. Sobald Hubble dann freigelassen war, fuhr ein motorgetriebener Stützrahmen aus, der die Solarsegel zwischen sich aufspannte. So jedenfalls der Plan.
Thermische Wechselbäder
Und noch etwas kam hinzu: Zwar waren die Solarsegel von Anfang an dafür ausgelegt, regelmäßig alle paar Jahre ausgetauscht zu werden. Dennoch mussten sie in der Zwischenzeit den extrem harten Bedingungen des niedrigen Erdorbits standhalten. „Alle 96 Minuten geht hier die Sonne auf und sinkt wieder“, erklärt Gerlach. „Jedes Mal ändern sich dabei die Temperaturen von plus 100 Grad in der Sonne auf minus 100 Grad im Schatten.“