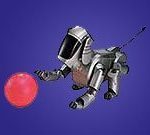Obwohl unser Gehirn so überaus kompliziert erscheint, sind die Modelle, die die Mathematik den modernen Hirnforschern an die Hand gibt, keineswegs immer nur auf Großrechner angewiesen. Im Gegenteil: Sie passen oft genug in einen Laptop. Und in ein unscheinbares Zimmer des Göttinger Instituts. Dort steht außerdem auf einem gewöhnlichen Tisch ein kleines Labyrinth aus Legosteinen.
Die Leute um den Tisch beschreiben, was sie sehen: „Wird er noch lange gegen die Wand rennen?“ „Ist er jetzt abgestürzt?“ „Nein: Er lebt noch. Er versucht, sich zu orientieren.“ „Jetzt hat er ein Erfolgserlebnis. Jetzt hat er gelernt, dass es auch hinter ihm weiter geht.“ Wer unangemeldet in den Raum tritt, dürfte vielleicht erwarten, in dem Labyrinth eine Ratte vorzufinden. Oder einen Käfer. Irgendwas aus Fleisch und Blut. Es ist aber ein kleiner Roboter.
Das Geheimnis dieser Maschine – ein apfelgroßer Platinenstapel mit Infrarotsensoren und zwei Rädern, der aussieht wie ein Minibaumkuchen – ist eine Art Nabelschnur, die von der Decke herabbaumelt. Sie führt zu einem Laptop neben dem Labyrinth. „Es würde auch ohne die Schnur gehen, wenn der Speicher des Roboters etwas größer wäre“, sagt Michael Herrmann, Mitglied der von Direktor Theo Geisel geleiteten Arbeitsgruppe für Nichtlineare Dynamik, die eng mit der Fakultät für Theoretische Physik an der Georg- August-Universität Göttingen zusammenarbeitet.
Herrmanns Laptop ist eine Art ausgelagertes Gehirn mit einem Programm, das die Sensoren des rollenden Baumkuchens mit Daten versorgen, das per Mausklick praktisch immer wieder neu geboren wird und stets von neuem lernt, sich in dem Legolabyrinth auf dem Tisch zurechtzufinden. Nun gehören Begriffe wie „Erfolgserlebnis“ und „neu geboren“ für gewöhnlich nicht zum Inventar eines Informatikers.