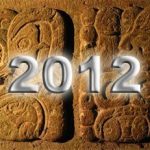Eine Blutprobe nehmen lassen, einen Fragebogen ausfüllen oder an einem Verhaltensexperiment teilnehmen fällt noch nicht unter Citizen Science. Entscheidend ist, dass die Teilnehmer selbst aktiv Forschung betreiben – sie sind keine bloßen Versuchskaninchen. Die Leitung haben dabei noch immer hauptberufliche Wissenschaftler. Sie geben den beteiligten Laien nötige Vorgaben, damit die Amateurforscher auch wissen, nach welchen Informationen sie suchen.
Vom Galaxien-Zoo ins Zooniversum
Wegbereitend waren simpel klingende Fragen nach der Form von Galaxien: Welche Galaxien auf diesen Fotos sind elliptisch, welche spiralförmig? Falls spiralförmig, in welche Richtung drehen sich die Arme? Die Fotos stammten aus dem Sloan Digital Sky Survey und zeigten hunderttausende von Galaxien – jede einzelne davon zu klassifizieren, hätte Jahre gedauert.

So entstand „Galaxy Zoo„, das bis heute zu den bekanntesten Citizen Science Projekten gehört. Eine enorme Anzahl von freiwilligen Astronomiebegeisterten nahm sich die Bilder vor und klassifizierte die Galaxien online. In mehreren Folgeprojekten von Galaxy Zoo verfeinerten sich die Fragestellungen, Bilder aus anderen Quellen wie etwa dem Hubble-Weltraumteleskop kamen hinzu. So entstand eine gewaltige Datenbank von Galaxien, sortierbar nach unterschiedlichen Eigenschaften wie Form, Farbe, Größe und vielem mehr – eine unerschöpfliche Datenquelle für Astronomen.
Vor allem, wie Galaxien im Laufe ihrer Entwicklung ihre Form und auch ihre Farbe wechseln, konnten die Forscher so herausfinden. Ergebnisse von „Galaxy Zoo“ waren die Grundlage für bislang 48 wissenschaftliche Artikel innerhalb der letzten acht Jahre. Da „Galaxy Zoo“ so erfolgreich war, entstanden schnell weitere Projekte nach demselben Muster. Viele davon sind nun über das aus „Galaxy Zoo“ hervorgegangene Internet-portal „Zooniverse“ erreichbar.