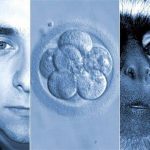Im Idealfall passen Spender und Empfänger perfekt zueinander. Denn je stärker sich ihre Gewebemerkmale voneinander unterscheiden, desto heftiger rebelliert das Immunsystem nach der Organtransplantation. Die körpereigene Abwehr erkennt fremd und eigen anhand charakteristischer Proteine auf der Oberfläche der Körperzellen, den sogenannten HLA-Strukturen. Stimmen diese gut überein, können besonders starke Abstoßungsreaktionen von vornherein vermieden werden.

Immunsystem in Alarmbereitschaft
Trotzdem wird das Immunsystem bei fast jeder Transplantation in Alarmbereitschaft versetzt und beginnt, den „Eindringling“ im Körper zu bekämpfen. Binnen Stunden, Tagen oder Wochen nach dem Eingriff kann es dadurch zur Abstoßung des fremden Organs kommen.
Doch nicht nur das: Selbst bei einer zunächst erfolgreichen Transplantation entwickelt sich mitunter nach Monaten oder Jahren eine gefährliche Immunabwehr. Schuld an dieser chronischen Abstoßung ist eine sich langsam aufbauende Kettenreaktion, die von Immunzellen und Antikörpern ausgelöst wird und schließlich zum Verlust der Organfunktion führt.
Mittel mit Nebenwirkungen
Um das Risiko für solche Folgen zu minimieren, müssen transplantierte Patienten ein Leben lang Immunsuppressiva einnehmen – Medikamente, die die körpereigene Abwehr unterdrücken. Durch ihren Einfluss auf das Immunsystem tragen diese Mittel erheblich dazu bei, das fremde Organ funktionsfähig verhalten.