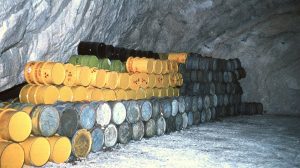1978 endet die Einlagerung von Atommüll im Bergwerk Asse II. Wegen seines Status als Versuchsendlager wird der Zustand des Salzstocks jedoch weiter überwacht. Das Augenmerk liegt dabei vor allem auf zwei wohlbekannten Eigenheiten von unterirdischen Salzvorkommen: Die Fähigkeit zur plastischen Verformung und die Entstehung von Salzlauge.

Um bis zu sechs Meter verformt
Salzgestein ist sehr tragfähig und in sich stabil, deswegen kommen Salzbergwerke weitgehend ohne zusätzliche Stützen aus – die Schachtwände und Kammerdecken tragen sich selbst. Dennoch bleibt der auflastende Druck nicht folgenlos: Anders als spröderes, aber formstabiles Gestein wie Granit gibt Salzgestein unter Druck nach. Je höher die Last, desto stärker verformt es sich.
Genau das passiert auch in der Asse: Weil die Hälfte des Salzgesteins im Salzstock fehlt, ist der Rest einem enormen Druck ausgesetzt. An einigen Stellen hat sich das Salz dadurch schon um mehr als sechs Meter verschoben. Decken von Gängen und Kammern sind eingesunken, tragende Wände seitlich verformt. Diese Veränderungen setzen sich bis ins darüberliegende Deckgebirge fort. Dieses verschiebt sich pro Jahr um rund 15 Zentimeter, wie Messungen ergeben haben.
13.500 Liter Salzlauge – jeden Tag
Das Problem dabei: Auch Salz ist nicht endlos verformbar. Irgendwann wird die Belastung zu hoch und es bilden sich Risse, im Extremfall können dadurch ganze Teile des Salzstocks einstürzen. Schon vorher jedoch eröffnen die Risse und Spalten im Salzgestein einer weiteren Gefahr den Weg – dem Wasser. Bereits während der Einlagerung des Atommülls in der Asse drang in den tieferen Sohlen immer wieder Salzlauge ins Bergwerk ein. Weil dieser Einstrom aber nur punktuell passierte und 500 bis 700 Liter nicht überschritt, galt dies als „beherrschbar“: Man dichtete die Risse mit Zementbarrieren ab und pumpte den Rest der Lauge ab.