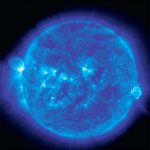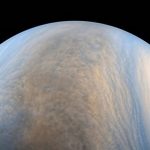Der Erfolg des griechischen Sphärensystems ist ein gutes Beispiel für die Schwierigkeit des Menschen, etablierte Denksysteme zu durchbrechen. Das geozentrische Weltbild und die Kugelschalen waren so fest mit der Philosophie und der Weltsicht damaliger Denker verzahnt, dass auch verbesserte Beobachtungsapparaturen, die nach und nach weitere Unstimmigkeiten zutage brachten, nicht zur Aufgabe dieses Modells führten. Stattdessen versuchte man, das bestehende Weltbild durch Erweiterungen an die neuen Beobachtungen anzupassen – mit eher geringem Erfolg.

Besonders „verdienstreich“ waren hierbei etwa Eudoxos von Knidos um 370 vor Christus, Hipparchos von Nikäa und ihr Nachfahre, der durch sein Gesamtwerk der antiken Astronomie berühmt gewordene Claudius Ptolemäus. Eudoxos etwa verkomplizierte das Sphärensystem, indem er jedem Planeten sowie Sonne und Mond ein ganzes eigenes Sphärensystem – anstelle jeweils einer einzigen Sphäre – zuordnete. Auch Hipparchos und Ptolemäus trugen nicht zu einem Umdenken bei, denn auch sie erweiterten das Modell nur um neue Beobachtungen und Erkenntnisse anstatt es zu überdenken.
Von der Armillarsphäre zum Astrolabium
Von den Mesopotamiern hatten die Griechen bereits ein wichtiges Instrument zur Winkelmessung übernommen: Eine Armillarsphäre besteht aus mehreren ineinander und gegeneinander drehbaren Metallringen, die gemeinsam eine Kugel ergeben. In der damals verwendeten Armillarssphäre befindet sich die Erde im Zentrum der Kugel, die drehbaren Ringe hingegen repräsentieren die Ekliptik, die Wendekreise, den Äquator oder den Horizont. Ebenfalls als Ring repräsentiert war ein Meridian – die gedachte Verbindung beider Pole. Werden die Ringe so eingestellt, dass sie für den jeweiligen Standort des Betrachters passen, lässt sich an ihnen ablesen, wie hoch beispielsweise die Sonne an einem bestimmten Tag über den Horizont steigen wird und wo sich bestimmte Sternbilder befinden.

Der größte Verdienst, den die antiken Griechen technisch in der Astronomie leisteten, war die Weiterentwicklung der Armillarsphäre zum Astrolabium. Am gravierendsten unterscheiden sich die beiden Instrumente darin, dass die zur Messung benötigten Skalen – Äquator, Wendekreis, etc. – im Astrolabium nicht mehr als Ringe einer Kugel repräsentiert sind, sondern in die Ebene projiziert werden. So befinden sich auch die Ekliptik und der Horizont als Kreise auf einer festen Scheibe, mit häufig je nach Standort austauschbaren Einlegescheiben. Der Beobachter muss sich hier nicht mehr gedanklich auf die bei der Armillarsphäre noch im Zentrum befindliche Erde versetzen. Er kann mit den richtigen Einstellungen der Kreise zueinander – z.B. dem Datum – direkt von seinem Standort aus den Himmel anpeilen.