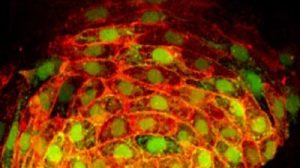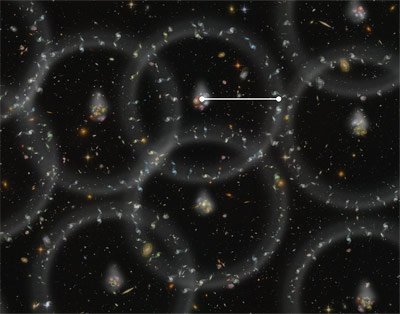Oktober 1951, Universität von Chicago. Der Student Stanley Miller besucht eine Vorlesung des Nobelpreisträgers Harold Urey, in der dieser Theorien zur Zusammensetzung der frühen Atmosphäre der Erde erörtert. Urey vertritt die Vorstellung, dass in einer reduzierenden Atmosphäre mit Methan, Ammoniak und Wasserstoff die besten Voraussetzungen gegeben seien, um organische Verbindungen, die Bausteine des Lebens, entstehen zu lassen. Und er schlägt vor, dass irgend jemand doch mal ein entsprechendes Experiment konzipieren könnte – ein Vorschlag, den der junge Miller prompt befolgt.
„Wird wahrscheinlich eh nicht funktionieren“
„Also ging ich zu ihm und sagte: Ich würde diese Experimente gerne machen“, erzählt Miller später in einem Interview mit Sean Henahan von Access Excellence und fährt fort: „Zuerst versuchte Urey mir die ganze Sache auszureden. Als er merkte, dass ich fest entschlossen war, erklärte er, es sei ein sehr riskantes Experiment und würde wahrscheinlich ohnehin nicht funktionieren und er sei schließlich verantwortlich dafür, dass ich nach den drei Jahren meiner Graduate-Zeit einen Abschluss bekäme.“ Doch Miller bleibt stur und schließlich einigen sich beide auf eine sechsmonatige Testphase.
Urerde im Labor
Wie sich herausstellt, braucht der Forscher jedoch nur ein paar Wochen, um die Sensation perfekt zu machen. Ausgehend von den Annahmen Ureys beginnt er, sich eine Urerde im Laborformat zu basteln. In einem Glaskolben brodelt bald Millers „Urozean“, im Kolben darüber wabert die „Atmosphäre“, eine Mischung aus Methan(CH4), Ammoniak (NH3), Wasserstoff (H2) und dem aus dem Wasser aufsteigenden Wasserdampf.

Um jede Kontamination auszuschließen, verfrachtet der Forscher anschließend den gesamten Versuchsaufbau nach dem Befüllen für 18 Stunden in einen Autoklaven. Die Gasmischung setzt Miller kontinuierlichen elektrischen Entladungen aus – den „Blitzen“ seiner Miniaturwelt. Diese sollen die Energie für Reaktionen der Gase untereinander liefern.