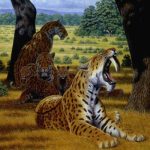Obwohl Paläontologen meist nur fünf Aussterbephasen in den Rang eines „Massenaussterbens“ erheben, hat es doch im Laufe der Erdgeschichte noch eine ganze Anzahl weiterer biologischer Krisen dieser Art gegeben. Einige von ihnen umfassten primär marine Lebensformen oder forderten „nur“ ein Drittel oder Hälfte aller Arten der jeweiligen Zeit, andere waren regional begrenzt oder löschten nur einzelne Tiergruppen aus, wie vor rund 11.000 Jahren das Aussterben der Großsäuger in Nordamerika.
Sind auch diese weniger schlimmen Phasen des Artensterbens reiner Zufall, ein Ausrutscher der Natur? Oder verbirgt sich vielleicht doch ein Prinzip, eine Gesetzmäßigkeit dahinter?
Gibt es einen Zyklus des Aussterbens?
Die beiden Paläontologen Sepkoski und Raup versuchten 1984, auch dieser Frage auf den Grund zu gehen. Wieder analysierten sie die Verteilung der Aussterbeereignisse über die Zeit und kamen zu einem erstaunlichen Ergebnis: Die Aussterbephasen von Familien meeresbewohnender Organismen schienen einem fast regelmäßigen Rhythmus zu folgen: Zwischen dem Perm vor 250 Millionen Jahren und der Gegenwart zeigte die weltweite Aussterberate im Durchschnitt alle 26 Millionen Jahre einen deutlichen Hochpunkt. Nur in zwei Zeitabschnitten- vor 120 und vor 170 Millionen Jahren – fehlte ein solcher Peak.
Kosmische Ursache?
Als wären diese Ergebnisse als solches nicht schon sensationell genug, setzten die beiden Forscher noch eins drauf: Sie postulierten, dass eine solche regelmäßige Wiederkehr von Massenaussterben nicht mit irdischen – geologischen – Mechanismen zu erklären sei. Sie glaubten stattdessen, nur eine kosmische Ursache käme für diese periodischen „Vernichtungsfeldzüge“ in Frage. Immerhin hatte man ja schon bei mindestens einem Massenaussterben, dem an der Kreide-Tertiär-Grenze, Hinweise auf einen möglichen Meteoriteneinschlag, warum also sollte dies nicht auch für die anderen Aussterbehöhepunkte gelten?