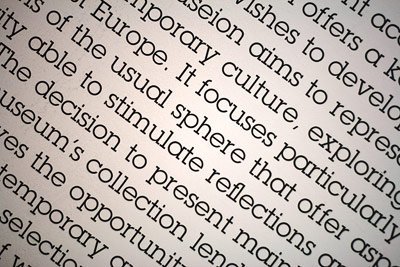Wenige Berufe sind so vertraut mit dem Wesen der Wörter wie die akademischen. Wörter sind das A und O unserer Profession. Sie halten unseren kumulativen Fortschritt fest, an ihnen wird unsere Produktivität gemessen, wenn wir Ideen mit Hilfe von Büchern, Zeitschriften und Open-access-Portalen verbreiten. Wie leicht verliebt man sich in das gedruckte Wort, in schwarze Symbole auf einem weißen Blatt mit ordentlichen Abständen, die die einzelnen Gedanken voneinander abgrenzen.
Aber wie anders ist doch unser alltäglicher Umgang mit Wörtern. Wir rollen sie auf unserer Zunge, wenn wir sprechen, flüstern oder schreien. Sie werden geschmeidig, wenn wir sie vortragen, verlängern und wiederholen. Wir schmücken sie mit subtilen Meinungsschattierungen aus, wenn wir Kontrolle auf Tonhöhe, Schallstärke und Dauer ausüben. Wir integrieren sie meisterlich mit Gestik und Mimik in das, was Linguisten „kompositionelle Äußerungen“ nennen.
Mehr als nur Beiwerk
Lange Zeit wurde das alles als Parasprache ausgegrenzt, als nicht Eigentliches, sondern als etwas am Rande, das uns nur ablenkt von der Wahrheit und Schärfe einer idealisierten formalen Sprache. Bei den Betrachtungen des Philosophen Gottlieb Frege über Sprache stehen ästhetische Freude und Streben nach Wahrheit in direkter Opposition.

Aber diese geringschätzige Ansicht ist inzwischen überholt, weil es Linguisten mehr und mehr klar wird, dass das geschriebene Wort nur ein mangelhaftes Modell für unsere wirkliche kommunikative Kompetenz ist. Sprache entstand in einer viel reichhaltigeren Umgebung und sie hat schon immer mehr für uns getan, als nur entkörperlichte Information zu liefern.