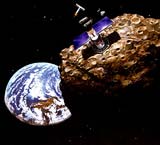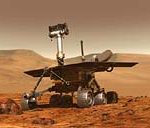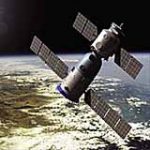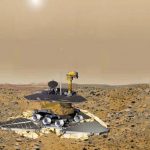In den 1960er Jahren überließ die Wissenschaft die Zukunftsvisionen von einem Leben im All nicht mehr nur den Science-Fiction Autoren. Ingenieure, Physiker und Astronomen begannen, sich mit den technischen Grundlagen von Orbitalstationen und Planetenbasen zu beschäftigen. In zahlreichen Veröffentlichungen wurde über neue Antriebssysteme, Konstruktionen und die günstigste Lage für Weltraumsiedlungen debattiert.
Inseln im All
Dandridge Cole, ein Ingenieur der Raketen- und Raumfahrtabteilung von General Electric hatte schon vor der ersten Mondlandung die Pläne für den übernächsten Schritt des Weltraumprogramms parat. In seinem 1964 erschienen Buch "Islands in Space" (Inseln im All) trat er mit Nachdruck dafür ein, zuerst eine Expedition zu den erdbahnkreuzenden Asteroiden und Kleinplaneten auszurüsten. Ein solcher Flug könne nicht nur eine wichtige Vorstufe zu einer Erkundung anderer Planeten sein, sondern auch eine entscheidende Rohstoffquelle für weitere Flüge eröffnen.
Zusammen mit dem Astronomen Brian O'Leary entwarf Cole ein Konzept, das vorsah, zunächst die Rohstoffe der Asteroiden und des Mondes auszubeuten und aus diesen dann Weltraum- und Mondstationen zu errichten. Beide vertraten das Prinzip, dafür möglichst wenig Material von der Erde zu nutzen und auf die Sonne als Energielieferanten zurückzugreifen.
Orbit als erste Wahl?
1969 lernte O'Leary bei einem Auswahlverfahren für Astronauten den Physiker Gerard O'Neill kennen. Der an der Princeton Universität als Professor angestellte Hochenergiephysiker war zu dieser Zeit bereits für seine Entwicklung des ersten Teilchenbeschleunigerrings bekannt und hatte unter anderem am amerikanischen Apollo-Program mitgearbeitet. Die Begegnung mit O' Leary gab ihm den Anstoß, sich noch intensiver mit den möglichen Formen und Konstruktionen von menschlichen Siedlungen im All zu beschäftigen.