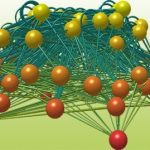Die Klontechnik stellt eine weitere Methode dar, mit deren Hilfe ausgerottete Tierarten ins Leben zurückgeholt werden könnten. Mit Schaf „Dolly“ fing am 5. Juli 1996 alles an: Seine Geburt bewies, dass die Erzeugung von Klonen aus bereits ausdifferenzierten Körperzellen von Säugetieren möglich ist.

Für diesen sogenannten somatischen Zellkerntransfer wird der Nucleus einer Körperzelle entnommen und in eine entkernte Eizelle verpflanzt. Dort wird er durch die Umgebung reprogrammiert und in einen undifferenzierten Zustand versetzt. Als Folge kann sich aus der Zelle ein Embryo entwickeln. Das Lebewesen, das daraus entsteht, ist eine genetische Kopie des Zellkernspenders.
Gewebe aus dem Eis
Inzwischen haben Wissenschaftler auf diese Weise bereits Schweine, Rinder, Mäuse, Hunde und zuletzt sogar Affen geklont. Warum sollten sie sich nicht auch einmal an einem ausgestorbenen Tier versuchen? Der Vorteil: Anders als bei einer Rückzüchtung wäre das Ergebnis tatsächlich ein genetisches Abbild anstatt lediglich eine Annäherung. Der Nachteil: Ein Klonversuch ist nur mit weitestgehend intakten Zellen der ausgerotteten Art möglich.
Zum Glück für erst in jüngster Vergangenheit von der Erde verschwundene Spezies lassen sich solche Zellen aus eingefrorenen Gewebeproben gewinnen – so bereits geschehen beim Pyrenäensteinbock (Capra pyrenaica pyrenaica). Wissenschaftler hatten sich von dem letzten lebenden Individuum dieser Art ein Stückchen Haut gesichert, Zellen daraus im Labor kultiviert, sie in flüssigem Stickstoff konserviert und später Kerne daraus in Eizellen von Hausziegen verpflanzt.