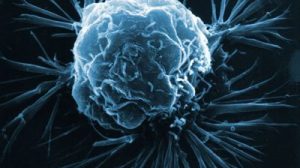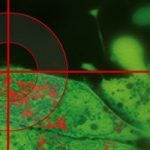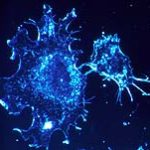Wenn ein Kind mit einer Krebserkrankung kämpft, nach einer erfolgreichen Therapie oder wenn der Krebs trotz aller Anstrengungen nicht geheilt werden konnte, muss auch die betroffene Familie unterstützt werden. Aber leider stimmen noch nicht immer alle zu, wenn es heißt: Die ganze Familie ist der Patient. „Jedes Mitglied der Familie hat seine individuellen Bedürfnisse“, erklärt Roland Wehrle, Stiftungsvorstand der Deutschen Kinderkrebsnachsorge – Stiftung für das chronisch kranke Kind. „Nach monatelangem Hoffen und Bangen, nach Getrenntsein von Eltern und Geschwistern
ist eine physische und psychische Stabilisierung der gesamten Familie wichtig.“
Für Wehrle ist das Manko in diesem Bereich nach wie vor ein schmerzliches Thema, auch wenn er und seine Mitstreiter bereits einige Erfolge erzielt haben. „Bis vor wenigen Jahren durfte man nicht einmal von familienorientierter Nachsorge sprechen“, erinnert er sich. „Dabei war die weitere Betreuung eines kleinen Patienten nie ein Problem. Doch für die Angehörigen wollte keiner zahlen. Ganz zu schweigen von den verwaisten Eltern, also jenen Eltern, die ein Kind durch Krebs verloren haben. Die bekommen erst in jüngster Zeit Unterstützung.“
Gratwanderung für Eltern und Kinder
Die Diagnose einer schweren Krankheit wie Krebs „zieht einem den Boden unter den Füßen weg“, wie Peter Kirsten (Name geändert) beschreibt. Vor drei Jahren wurde bei seiner damals achtjährigen Tochter Nina ein Tumor diagnostiziert, inzwischen scheint das Mädchen den Krebs überwunden zu haben. Und obwohl „wir unglaublich viel Rückhalt durch die Familie, Freunde und behandelnde Ärzte erfahren haben“, so der Vater, hat die ganze Familie drei extrem belastete Jahre hinter sich. Auf die Operation folgte die Chemotherapie, die Nina körperlich schwer mitnahm.
Mutter Kerstin beschreibt ihre Situation damals als „Gratwanderung für die ganze Familie“: „Wir alle haben uns Sorgen gemacht, hatten Angst, dass Nina stirbt. Aber trotz aller Sorge um Nina mussten wir ja auch für unsere zweite Tochter Anna da sein – die hatte ja auch ihre Alltagssorgen, ihre Wünsche. Und wir wollten sie nicht benachteiligen.“ Noch während Ninas Chemotherapie beantragten die Kirstens eine Reha – nicht nur für die kranke Tochter, sondern für sie alle vier.
„Jedes Mitglied der Familie hat seine individuellen Bedürfnisse“, weiß Roland Wehrle, der bereits vor 25 Jahren maßgeblich an der Konzeption der Familienorientierten Nachsorge beteiligt war: „Nicht nur der Körper der kleinen Patienten braucht Zuwendung, auch ihre Psyche. Nach schweren Operationen und Behandlungen, nach monatelangem Hoffen und Bangen, nach Getrenntsein von Eltern und Geschwistern, ist eine physische und psychische Stabilisierung der gesamten Familie ein zentrales Element, das heißt, nicht nur der Patient, sondern auch die Eltern und Geschwister werden medizinisch und psychologisch betreut.“ Was Wehrle so nüchtern beschreibt, hieß für Familie Kirsten ganz konkret: „Endlich wieder einmal Zeit nur für uns. Zeit für Sport, Zeit für Gespräche“, beschreibt Peter Kirsten.
Tauziehen um die Finanzierung
Der Auffassung, dass die Familienorientierte Nachsorge im Rahmen einer Rehabilitationsmaßnahme zur langfristigen Sicherung des Heilungserfolges unabdingbar ist, schlossen sich anfangs nicht alle Renten- und Krankenversicherungen an. Es war ein zäher Kampf, bis es 2009 endlich zu einer
Verfahrensabsprache kam. Zwar agieren die Kostenträger bei der Übernahme einer familienorientierten Nachsorge inzwischen deutlich kulanter, doch gibt es immer noch Fälle, in denen die Deutsche Kinderkrebsnachsorge den Klinikaufenthalt über ihren Hilfsfonds zunächst absichert
und das Recht der Familien auf eine ganzheitliche Behandlung juristisch durchfechten muss.
Ein Umstand, der Wehrle ärgert. „Man muss immer wieder betonen, dass es sich keine Familie ausgesucht hat, ein schwer krankes Kind zu haben“, sagt er. „Bundesweit machen weniger als 2.000 Familien im Jahr solch eine Reha und dabei reden wir über Kosten von 6.000 bis 10.000 Euro. Die belasten unser Gesundheitssystem nur unwesentlich.“
Die Nachsorgeklinik Tannheim im Schwarzwald, deren Geschäftsführer Wehrle ist, ist ihm zufolge seit Jahren zu hundert Prozent belegt. Und trotzdem ist sie auf Spenden angewiesen: „Wir brauchen eine halbe Million Euro an Spenden im Jahr“, sagt er. „Das zeigt mir, dass nicht nur die Prioritäten falsch gesetzt werden und die Tragweite der Erkrankung verkannt wird, sondern auch, dass wir in diesem relativ reichen Land noch immer zu wenig übrig haben für kranke Kinder. Es ist die Aufgabe der Solidargemeinschaft, zu helfen. Denn Kinder sind unsere Zukunft.“
Stand: 25.05.2012