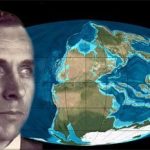Trotzdem gelten sie als Hochgebirge.
Für die Charakterisierung von Gebirgsräumen reichen Kriterien wie
Höhe und Relief allein also nicht aus.
Höhenstufung
Der Landschaftsökologe Carl Troll versuchte sich in den fünfziger Jahren in einer Abgrenzung, die klimatische, vegetationskundliche und geomorphologische Kriterien einbezieht. Durch den landschaftsökologisch inspirierten Ansatz Trolls werden Gebirge „als Körper mit einer vertikalen Landschaftsgliederung“ beschrieben. Gemeint ist damit: Die in den verschiedenen Höhenstufen von Gebirgen unterschiedlichen Klimaverhältnisse führen zu jeweils unterschiedlichen Vegetations- und Oberflächenformen.
Alle Hochgebirge besitzen nach Troll dabei folgende Gemeinsamkeiten: Sie erheben sich über die Waldgrenze, besitzen Formen aus der vergangenen Eiszeit – wie Trogtäler oder schroffe Felsen – und liegen im Bereich dauerhaft gefrorenen Bodens. Aber auch hier gibt es streng genommen Ausreißer: Gebirge in polaren Breiten sind nicht bewaldet und Spuren eiszeitlicher Vergletscherung sind selbst in geringen Höhen zu finden. Hochgebirge in den wechselfeuchten Tropen erreichen demgegenüber die Baumgrenze oftmals nicht – sie sind bis zum Gipfel bewaldet.
Plattentektonik
Also was noch? Gebirge sind nicht willkürlich auf der Erde verteilt, sondern räumlich an die Prozesse der Plattentektonik gebunden. Dort wo verschiedene kontinentale oder ozeanische Platten aneinanderstoßen, werden Gebirge aufgetürmt oder Vulkane entstehen. Die Hochgebirge der Erde – wie die Anden, der Himalaya oder die Alpen – haben daher eine Gemeinsamkeit: sie sind mit nur etwa 60 Millionen Jahren „junge“ Gebirge, die in geologisch aktiven Zonen liegen. Ihre Gebirgsbildung ist noch nicht abgeschlossen, sie dauert noch heute an.
So dringt die indische Platte mit fünf Zentimeter pro Jahr in den asiatischen Kontinent ein, so dass der Himalaya sich stetig hebt. Dass die Hochgebirge in den Himmel wachsen, verhindern jedoch die
von außen wirkenden Abtragungskräfte
wie Verwitterung und Erosion. Hohe Abtragungsraten sind somit eine weitere Gemeinsamkeit von Hochgebirgen. Die Alpen verlieren jährlich einen Millimeter durch Erosion – diese wirkt der andauernden Hebung entgegen. Mittelgebirge hingegen – wie das Rheinische Schiefergebirge, der Schwarzwald, die Vogesen oder die Appalachen – haben ihre „Hoch“zeit schon hinter sich. Sie sind 250 Millionen Jahren alt und abgetragen. Hochgebirge und Mittelgebirge gehören daher verschiedenen so genannten „Reliefgenerationen“ an.
Geomorphologische Formungsprozesse
Die zusammenstoßenden Platten türmten die Erdkruste zu Gesteinsmassiven auf – ihr äußeres Erscheinungsbild bekommen Gebirge jedoch erst durch die Formungsarbeit der von außen angreifenden Kräfte wie Wind, Wasser oder Eis. Nimmt man das Beispiel der Alpen: erst im Laufe der Erdgeschichte wurde der Gesteinskörper infolge der wechselnden klimatischen Bedingungen modelliert – die Alpen bekamen ihr heutiges Gesicht.
So schuf das subtropisch warm-feuchte Klima im Tertiär, vor etwa 40 Millionen Jahren, im Zusammenspiel mit verschiedenen tektonischen Hebungen zunächst eine flachwellige Landschaft – die wohl so ausgesehen haben muss wie unsere Mittelgebirge heute. Im darauffolgenden Pleistozän, vor 1,6 Millionen Jahren, kühlte sich das Klima jedoch wieder ab und Gletscher bedeckten das junge Gebirge. Diese schürften tiefe Täler und Wannen in den Felsuntergrund. Frost zersprengte die Gesteine und schroffe Felsgipfel entstanden.
Die formschaffenden Kräfte in der Gegenwart – dem Holozän – wirken demgegenüber wieder ausgleichend, das steile Relief wird nach und nach eingeebnet – ein Prozeß der nach der menschlichen Zeitrechnung noch lange andauern wird. Wie dieses Beispiel zeigt, spielt bei der Charakterisierung von Hochgebirgen auch die Formung der Oberfläche eine große Rolle. Hochgebirge sind demnach nicht nur tektonisch, sondern auch geomorphologisch aktive Gebiete.
Stand der Hochgebirgsforschung
Die verschiedenartigen Abgrenzungsversuche von Hochgebirgen spiegeln den historischen Verlauf bzw. den Stand der Hochgebirgsforschung wider. Hatte diese in ihren Anfängen einen rein beschreibenden Charakter, stehen heute komplexe Systemanalysen und die Quantifizierung von Prozessen wie die Erosionsleistung von Gletschern, die Transportmenge von Sedimenten durch Gebirgsbäche oder die Geschwindigkeit von Murgängen im Vordergrund.
Wissenschaftler versuchen, die in Gebirgen vorherrschenden Prozesse in einen funktionalen Zusammenhang zu bringen und daraus Modelle abzuleiten. Angesichts des globalen Klimawandels gewinnen diese für die Entwicklung von Szenarien und zur Folgenabschätzung immer stärker an Bedeutung.
Stand: 23.03.2002
23. März 2002