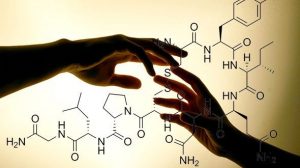Es scheint naheliegend: Wenn unsere sexuelle Orientierung biologische Wurzeln hat, dann müssten die Hormone eine Rolle spielen. Denn sie beeinflussen nicht nur viele unserer Stimmungen und Reaktionen, sie prägen auch unser Geschlecht. Im Mutterleib entscheidet letztlich erst die Präsenz und Dosierung der Geschlechtshormone, ob sich aus einem Embryo ein Junge oder ein Mädchen entwickelt. Und nach der Pubertät sind es vor allem Testosteron und Östrogen, die das Wachstum von Bart oder Busen steuern.

Was verrät der Hormonspiegel?
Doch mischen diese Hormone auch bei unserer sexuellen Orientierung mit? Diese Frage haben Forscher schon in den 1980er Jahren untersucht, indem sie Blutproben von homosexuellen und heterosexuellen Frauen und Männern auf ihren Hormongehalt hin analysierten. Das Ergebnis: Entgegen den Erwartungen unterschieden sich schwule und heterosexuelle Männer weder im Testosteron- noch im Östrogengehalt. Die einfache Vorstellung, das schwule Männer einfach zu wenig Testosteron produzieren und daher „weiblichere“ Männer sind, war damit weitgehend vom Tisch.
Weniger eindeutig sieht es dagegen – mal wieder – beim weiblichen Geschlecht aus: Hier haben Wissenschaftler tatsächlich hormonelle Unterschiede zwischen homo- und heterosexuellen Frauen gefunden. In den meisten Studien hatten lesbische Frauen leicht höhere Testosteronwerte. Allerdings: Wegen des weiblichen Zyklus schwanken bei Frauen die Hormonwerte stärker als bei Männern. Und nicht alle Studien haben weitere Einflussfaktoren wie Körpergröße und Gewicht berücksichtigt. Inzwischen gehen Forscher davon aus, dass die Geschlechtshormone im Erwachsenalter für die sexuelle Orientierung kaum eine Rolle spielen.
Zwei Gendefekte und ihre Folgen
Anders sieht dies jedoch mit der Hormonversorgung im Mutterleib aus: Es gibt gleich mehrere Indizien dafür, dass die Menge an pränatalem Testosteron die sexuelle Orientierung beeinflussen kann. Einen Hinweis liefern zwei Gendefekte: Bei der sogenannten kongenitalen adrenalen Hyperplasie (CAH) produzieren die Hormondrüsen des Fötus statt des Stresshormons Cortisol das männliche Geschlechtshormon. Als Folge bekommen genetisch weibliche Ungeborene viel zu viel Testosteron. Die Folge: Als Erwachsene sind deutlich mehr dieser Frauen lesbisch als es dem Durchschnitt entspricht.
Und auch den umgekehrten Fall gibt es: Bei Menschen mit einer Kompletten Androgenresistenz (CAIS) ist der Rezeptor für das männliche Geschlechtshormon wegen eines Gendefekts deaktiviert. Als Folge reagieren die Zellen und Gewebe des Ungeborenen nicht auf Testosteron – und genetisch männliche Föten entwickeln sich als Mädchen. Fast alle CAIS-Patienten fühlen sich später zu Männern hingezogen – bezogen auf ihr genetisches Geschlecht sind sie homosexuell.

Das Geheimnis der Fingerlänge
Buchstäblich auf der Hand liegt ein weiteres Indiz für einen pränatalen hormonellen Einfluss: die Länge unserer Finger. Typischerweise ist bei Männern der Ringfinger etwas länger als der Zeigefinger. Bei Frauen ist es meist umgekehrt oder beide Finger sind gleich lang. Forscher haben herausgefunden, dass dieses sogenannte 2D:4D-Verhältnis durch die Testosteronwerte im Mutterleib bestimmt wird. Je mehr Testosteron der Fötus bekommt, desto ausgeprägter ist der Fingerlängen-Unterschied.
Das Interessante daran: An den Fingerlängen lässt sich häufig die sexuelle Orientierung ablesen – zumindest bei Frauen. Studien zeigen, dass lesbische Frauen im Schnitt eher ein „männliches“ 2D:4D-Verhältnis besitzen. Ihre Ringfinger sind demnach ähnlich wie bei den meisten Männern länger als ihre Zeigefinger. Bei homo- und heterosexuellen Männern sind die Befunde allerdings weniger eindeutig. Einige Wissenschaftler fanden gar keine Unterschiede, andere beobachteten bei schwulen Männern sogar „hypermännliche“ 2D:4D-Verhältnisse.
Nicht nur Testosteron?
Testosteron ist jedoch möglicherweise nicht das einzige Hormon, das schon im Mutterleib die Weichen stellt. Auch das Gelbkörperhormon Progesteron könnte eine Rolle spielen, wie eine im Jahr 2017 veröffentlichte Studie ergab. June Reinisch von der Indiana University und ihre Kollegen hatten dafür 17 Männer und 17 Frauen untersucht, die zwischen 1959 und 1961 am Universitätsklinikum Kopenhagen geboren worden waren. Ihre Besonderheit: Alle 34 Probanden waren im Mutterleib erhöhten Progesteron-Dosen ausgesetzt, weil ihre Mütter damals ein Hormonpräparat gegen eine drohende Fehlgeburt bekommen hatten.
Die Frage war nun: Hatte die pränatale Progesteron-Schwemme die sexuelle Orientierung dieser Personen beeinflusst? Die Auswertung ergab: „Verglichen mit nicht-exponierten Personen identifizierten sich weniger dieser Männer und Frauen als heterosexuell“, berichten die Forscher. „Sie berichteten zudem vermehrt über gleichgeschlechtliche Anziehung und entsprechende Sexualkontakte.“ Nach Ansicht von Reinisch und ihren Kollegen spricht dies dafür, dass auch das Progesteron am komplexen Gefüge unserer sexuellen Orientierung mitmischen könnte.
Zusammenfassend bedeutet dies: Es gibt zahlreiche Indizien dafür, dass die Hormonwerte im Mutterleib eine wichtige Rolle für unsere sexuelle Orientierung spielen. Welche Mechanismen jedoch dabei greifen und welche Hormone welche Wirkung nach sich ziehen, ist bisher weitgehend ungeklärt.
Nadja Podbregar
Stand: 29.06.2018