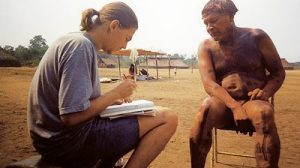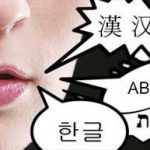Auch anhaltender kulturpolitischer Druck kann Sprachen zusetzen. Ein Beispiel ist Frankreich. Hier hat die lange praktizierte zentralistische Sprachpolitik viele einst verbreitete Regionalsprachen, wie Bretonisch oder Okzitanisch, stark in die Defensive gedrängt.

Zwischen Zwang und Toleranz
Der französische Bischof und Politiker Henri Grégoire präsentierte 1794 einen Bericht, in dem er für eine Unterdrückung der Regionaldialekte zur Rettung des Französischen plädierte. Dieser Plan bekam Gesetzeskraft bekam und sollte auf rabiate Weise das von nur zwölf Prozent der Bevölkerung Frankreichs gesprochene (Pariser) Französisch als alleinige Sprache durchsetzen sollte. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg rückte man von diesem Ziel ab. Die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen von 1992 hat Frankreich zwar 1999 unterzeichnet, aber bis heute nicht ratifiziert.
Hingegen versuchten die Römer der Antike zu keiner Zeit, die in den eroberten Provinzen angetroffenen Regionalsprachen durch das Lateinische zu ersetzen. Im Osten blieb ohnehin die Weltsprache Griechisch dominant, im Westen gaben Etrusker, Italiker, Gallier und Germanen ihre Sprachen freiwillig zugunsten des angeseheneren Lateinischen auf. Nur Inselkeltisch, Baskisch und Albanisch, alle in unwegsamem Gelände beheimatet, haben diesem zivilisatorischen Sog dauerhaft widerstanden.

Kleinere sind besonders gefährdet
Aber das sind seltene Ausnahmen. In der Regel leiden kleinere Sprachen unter der Nachbarschaft einer wichtigen überregionalen Verkehrs- und Kultursprache. Häufig schrumpfen dann ihre ursprünglich geschlossenen Verbreitungsgebiete und zerfallen in dialektal auseinanderstrebende Inseln, was ihren Niedergang weiter beschleunigt.
Selbst das seit 1945 sprachenpolitisch gut gestellte Sorbische in Sachsen und Brandenburg ist mittlerweile fast völlig in das stark bedrohte Niedersorbische und das stabilere Obersorbische gespalten, da es im Übergangsgebiet kaum noch Sprecher gibt. Das ehemals kompakte Sprachkontinuum des Friesischen ist heute in drei untereinander nicht mehr verständliche Idiome zerfallen: das vitale Westfriesische in den Niederlanden, das fast verschwundene Ostfriesische im Saterland und das als „ernsthaft gefährdet“ eingestufte Nordfriesische.
Werner Arnold und Gerrit Kloss, Universität Heidelberg / Ruperto Carola
Stand: 10.03.2017