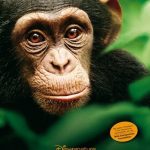Jeder, der schon einmal eine Naturdokumentation gesehen hat, weiß: Tiere kämpfen gegeneinander. Sei es um Reviere, um Nahrung, um das Recht auf Fortpflanzung oder um sich selbst und den eigenen Nachwuchs vor Raubtieren zu beschützen. Dabei nutzen die Duellanten angeborene Waffen wie Hörner, Krallen und Reißzähne. Doch nur weil es zwischen Tieren hin und wieder brutal zugeht, würde man noch lange nicht von einem Krieg sprechen. Oder?

Zwischen Kampf und Krieg
Per Definition der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung ist ein Krieg ein organisierter Konflikt, der mit Waffen gewaltsam ausgetragen wird. Zwar würden die Worte „Konflikt“, „Waffen“ und „gewaltsam“ durchaus auch auf den Kampf einer Nashornmutter gegen ein Rudel Löwen zutreffen, doch „organisiert“ ist eine solche Auseinandersetzung wahrscheinlich weniger. Zwar gehen Löwen bei der Jagd im Rudel taktisch vor, doch ihr Ziel ist trotzdem simpel: Abendessen. Ihr Angriff auf die Nashornmutter ist keine orchestrierte Schlacht, um die Vorherrschaft über die Nashörner zu erlangen.
Menschliche Kriege hingegen sind hochorganisiert und durchgeplant. Jeder Schachzug, jeder Angriff, jeder Bluff ist genaustens durchdacht und dient einzig und allein dem Zweck, den Gegner zu übertrumpfen. Wir spionieren den Feind gezielt aus, bringen unsere Truppen in Position, inszenieren Ablenkungen und bauen tödliche Waffen für die Schlacht.

Krieg als Teil der menschlichen Kultur
Doch für uns Menschen sind Kriege nicht einfach nur vereinzelte, grausame Ereignisse. Sie sind gewissermaßen Teil unserer Kultur. Nicht umsonst besitzen die meisten Länder große Heere mit Soldaten, die intensiv für den Kampf geschult sind. Allein die USA investieren jedes Jahr umgerechnet über 800 Milliarden Euro in ihr Militär. Auf Kampf und Krieg vorbereitet zu sein, scheint ein essenzieller Bestandteil unseres politischen und gesellschaftlichen Systems zu sein.