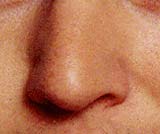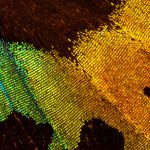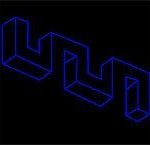Folgen wir der Geruchsspur ins Mikroskopische: Alle duftenden Gegenstände geben flüchtige Moleküle in die Luft ab. Fast alle natürlich vorkommenden Gerüche sind komplizierte Gemische aus Hunderten verschiedener Moleküle. Trotzdem genügen meist einige so genannte Leitsubstanzen, um einen bestimmten Geruch zu charakterisieren.
So lässt sich mit Amylacetat Bananenduft imitieren, Geraniol erzeugt einen rosenähnlichen Eindruck und Skatol den von Fäkalien. Allerdings bemerken unsere Nase und unser Gehirn sehr schnell, dass noch etwas fehlt: Das macht den Unterschied aus zwischen einem Nahrungsmittel mit künstlichen Aromastoffen und einem aus den natürlichen Produkten.
Im obersten Bereich der menschlichen Nase finden wir das so genannten Riechepithel, das aus den eigentlichen Riechzellen, den Stützzellen und den Basalzellen besteht. Die Basalzellen sind adulte Stammzellen, die unser ganzes Leben lang im Vierwochentakt die 30 Millionen Riechzellen erneuern. Die Riechzellen tragen am Ende rund 20 feine, in den Nasenschleim ragende Sinneshärchen (Cilien). Deren Zellmembran enthält alle molekularen Komponenten, die dafür sorgen, dass wir mehr als 10.000 verschiedene Düfte selbst in geringsten Konzentrationen wahrnehmen und unterscheiden können.
Die Umsetzung des chemischen Duftreizes in ein elektrisches Zellsignal erfolgt über einen kaskadenartigen biochemischen Verstärkungsmechanismus: Jeder Duftstoff muss zuerst ein spezifisches Rezeptoreiweiß auf der Oberfläche der Sinneshärchen finden und daran andocken. Der Rezeptor benutzt dann so genannte G-Proteine als Vermittler, um ein Enzym (Adenylatzyklase) zu aktivieren. Dieses Enzym kann große Mengen zyklisches Adenosinmonophosphat (cAMP) als zweiten Botenstoff herstellen.