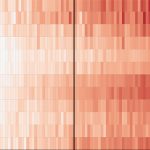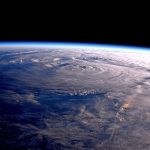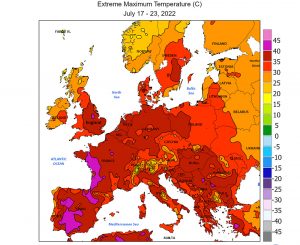Die entscheidende Frage in der Attributionsforschung ist, ob der Klimawandel zu einem Ereignis beigetragen hat. Hat er Schuld, wenn beispielsweise eine Hitzewelle oder eine Flutkatastrophe inzwischen deutlich häufiger in einem Gebiet vorkommt als es früher der Fall war? Um das herauszufinden, folgt nach Definition der Parameter und Auswertung der historischen Wetterdaten nun der dritte Schritt in der Attribution: die Modellierung.
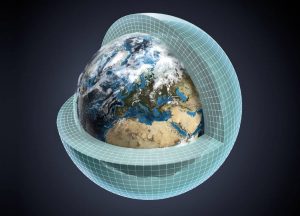
Die Wahl der passenden Klimamodelle
Dafür nutzen die Forschenden mehrere verschiedene Klimamodelle, um das Klima- und Wettergeschehen für die betroffene Region zu rekonstruieren. Zunächst prüfen sie dabei, ob die betreffenden Modelle geeignet sind, um das Geschehen präzise und korrekt abbilden können. „Ein Modell mit einer Auflösung von 200 Kilometern kann einen tropischen Zyklon mit 25-Kilometer großen Strukturen oder ein Gewitter von nur wenigen Kilometern Ausdehnung nicht repräsentieren“, erklären Sjoukje Philip vom Königlich Niederländischen Meteorologieinstitut und ihre Kollegen.
Umgekehrt kann ein nur lokales oder regionales Modell großräumige atmosphärische Prozesse nur in Teilen erfassen. Wichtige Einflussfaktoren für ein Extremereignis könnten daher fehlen. Auf ähnliche Weise muss auch die zeitliche Auflösung eines Klimamodells passen: Kann es kurzfristige Veränderungen wie ein Gewitter abbilden oder aber die langfristigen Wetterlagen, die zu einer Dürre führen?
Die Simulationen
Ist dies geklärt und der passende Satz an Klimamodellen ausgewählt, folgen die Simulationen. Dabei wird das Klima- und Wettergeschehen zunächst tausende Male unter den tatsächlich herrschenden Bedingungen inklusive der Treibhausgas-Werte und der globalen Erwärmung rekonstruiert. „Vereinfacht gesagt lässt man auf den Computern immer und immer wieder dieselben Klimamodelle mit ganz leicht veränderten Ausgangsbedingungen durchlaufen“, beschreiben Ben Clarke und Friederike Otto von der World Weather Attribution Initiative (WWAI) das Prinzip.