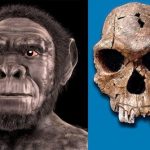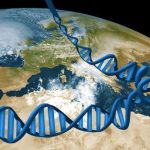Ralf W. Schmitz erklärt warum die Forscher gerade mitochondriale-DNA für den Vergleich zwischen Homo neanderthalensis und Homo sapiens verwenden: „Die mtDNA weist eine fünf bis zehnmal höhere Evolutionsrate auf als Kern-DNA. Die Evolutionsrate ist dabei ein Maß für die Veränderungen einer Gen-Sequenz pro Zeiteinheit. Außerdem“, fügt er hinzu, „weil auf einen Satz Kern-DNA einige Hundert bis 10.000 mtDNA-Stränge entfallen, sind die Chancen der Erhaltung von mtDNA entsprechend größer.“
Genau hingeguckt
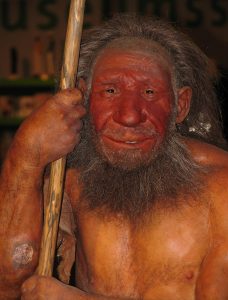
Für den Vergleich von Neandertaler und Mensch analysierten Krings und seine Kollegen besonders aussagekräftige Abschnitte der mtDNA. Mittels der DNA-Sequenzierung ermittelten sie die genaue Nukleotidsequenz dieser Abschnitte, das heißt, sie kannten die genaue Abfolge der einzelnen Basenpaare des Genstückes, sowohl vom Neandertaler als auch von den untersuchten 994 Probanden der Spezies Homo sapiens aus allen Teilen der Welt. Anschließend verglichen sie zunächst die Sapiens-Sequenzen untereinander und ermittelten, an wie vielen Stellen sich ihre mtDNA voneinander unterschied. Es waren durchschnittlich acht Positionen von 379 Basenpaaren.
Im Vergleich mit der Sequenz des untersuchten Neandertalers sind es hingegen durchschnittlich 27 Positionen, also mehr als dreimal so viel. „Damit liegt der Neandertaler ganz am Rand der Variationsbreite der mtDNA heute auf der Erde lebender Menschen“, fügt Ralf Schmitz hinzu.
Kein moderner Europäer?
Schließlich verglichen die Wissenschaftler ihre Proben mit der entsprechenden Sequenz unseres nächsten Verwandten, dem Schimpansen. Die Abschnitte unterscheiden sich an 55 Positionen vom modernen Menschen. Krings und Co. errechneten dann mittels der „molekularen Uhr“, dass Homo sapiens und Homo neanderthalensis erst vor 500.000 Jahren aus einem gemeinsamen Vorfahren hervorgingen, also später als bisher angenommen.