Alison Bashford ist Wissenschaftshistorikerin an der University of New South Wales in Australien – sie untersucht, was Historiker und Geologen früherer Zeiten über Gondwanaland dachten und wie sich diese Vorstellungen im Laufe der Zeit verändert haben. So waren Wissenschaftler in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beispielsweise nicht davon überzeugt, dass die Idee der Plattentektonik überhaupt glaubwürdig sei, erklärt sie.
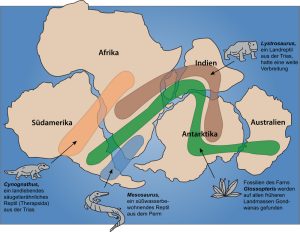
„Mit Atlantis in einem Topf“
Kein Wunder: Als Alfred Wegener – heute als Vater der Plattentektonik gefeiert – Anfang des Jahres 1912 seine Theorie von der Kontinentaldrift in einem Vortrag vorstellte, reagierten seine Fachkollegen mit Spott und Ablehnung. Die Idee von sich bewegenden Erdplatten und wandernden Kontinenten widersprach allem, was man damals zu wissen glaubte. Es dauerte noch fast ein halbes Jahrhundert, bis man die Theorie der Plattentektonik bewies und Wegener rehabilitierte. Bis dahin jedoch galt auch die Idee eines urzeitlichen Superkontinents als abwegig.
„Frühe Geologen haben Gondwanaland manchmal mit Atlantis in einen Topf geworfen“, sagt Bashford. „Sie wussten noch nicht wirklich, ob Gondwanaland existierte oder nicht. Es war eine Hypothese.“ Sogar der berühmte australische Antarktisforscher Douglas Mawson sei nicht davon überzeugt gewesen, dass Gondwanaland real sei, sagt sie. Er schrieb Anfang des 20. Jahrhunderts sogar eine fiktive Geschichte darüber, wie er sich in Gondwanaland verirrte.
Ort für Science-Fiction und Zeitreisen
Aber Gondwanaland galt nicht nur bei Geologen und anderen Wissenschaftler als fiktiv: Es wurde auch zu einem mythischen Ort – und taucht bis heute häufig in der Science-Fiction auf. „Gondwanaland ist ein fast mythischer Raum und Ort“, sagt Bashford. „Es taucht überall in der Belletristik auf, vor allem in der Science-Fiction. Das liegt zum Teil an dem Wort selbst – das ‚Land‘ in Gondwanaland suggeriert einen fremden Ort, etwas Jenseitiges.“














