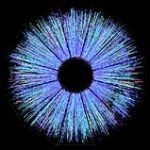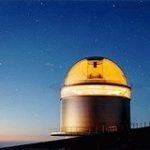Der forschende Blick in den Nachthimmel ist vermutlich so alt wie die Menschheit. Schon in den alten Hochkulturen beobachteten Gelehrte die Gestirne und versuchten in ihren Bewegungen Gesetzmäßigkeiten abzuleiten. Doch unser Bild vom Weltall beschränkte sich lange Zeit auf das sichtbare Spektrum – nur Objekte, die Licht aussendeten, konnten beobachtet werden. Auch heute noch assoziieren viele die Astronomie mit ihrem rein optischen Zweig: Der Arbeit von Forschern, die warten bis es dunkel wird und dann mit allen möglichen Hilfsmitteln in den Nachthimmel starren – immer auf der Suche nach fernen, leuchtenden Himmelsobjekten.
Doch die Astronomie ist viel mehr als das: Längst durchmustern Wissenschaftler den Himmel nicht mehr nur im sichtbaren Bereich, sondern im gesamten Spektrum der elektromagnetischen Strahlung, von den energiereichen Röntgenstrahlen bis zu den langwelligen Radiowellen. Zu den zahlreichen optischen Teleskopen sind immer mehr Röntgen-, Infrarot- und Radioteleskope sowohl auf der Erde als auch im All gekommen.
Diese neuen „Augen“ und „Ohren“ haben den Horizont der Astronomen erweitert und verändert. Auch wenn die Aufnahmen der Radioastronomen nur selten so spektakulär und detailreich sind wie die des Weltraumteleskops Hubble, zeigen schon die ersten Blicke auf Radiobilder des Himmels eine völlig neue Sicht, bei der Vertrautes fehlt und Neues aus dem Dunkel des Alls auftaucht.
Auf einer Karte des Radiohimmels sind die im optischen Bereich hell leuchtenden Sterne fast völlig unsichtbar, da starke „Lichtstrahler“ nur sehr selten auch gleichzeitig starke Radioquellen sind. Stattdessen dominieren im langwelligen Bereich rhythmisch aufblitzende Pulsare, Quasare, Radiogalaxien und strahlende Überreste von Sternenexplosionen, den Supernovae – kosmische Phänomene, die vor der Entdeckung der Radioastronomie völlig unbekannt waren.