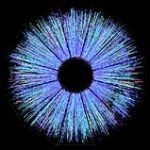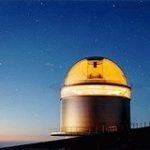Am 12. Juli wird das Jahrhundertprojekt ISS um ein weiteres Bauteil reicher sein – jedenfalls wenn alles so läuft wie geplant. Die Swesda, benannt nach dem russischen Wort für „Stern“, soll die beiden bereits im Orbit kreisenden Module Sarja und Unity ergänzen. Gemeinsam hat die „Zweier-Kombi“ aus dem in Russland gebauten Kontrollmodul und dem amerikanischen Verbindungselement seit ihrer Zusammenkopplung im Dezember 1998 die Erde bereits mehr als 9300 Mal umrundet. Nun erhalten sie Gesellschaft – wegen finanzieller Schwierigkeiten der russischen Raumfahrtbehörden allerdings mit gut einjähriger Verspätung.
Das Service-Modul Swesda ist der erste rein russische Beitrag zur Internationalen Raumstation. Sarja, das erste ISS-Modul im All, wurde zwar in Russland fertig gestellt und ist auch dort gestartet, beruht aber auf amerikanischen Plänen und ist eine Auftragsarbeit für die Raumfahrtbehörde NASA. Die Swesda basiert dagegen auf dem Vorbild des Kernmoduls der russischen Raumstation Mir. Wie dieses wird auch sie – zumindest in der Aufbauphase der ISS – das Herzstück der Station sein.
Damit der Zuwachs der ISS reibungslos klappt, hat die Besatzung der Raumfähre Atlantis im Mai 2000 bereits letzte Vorbereitungen getroffen: Sie führten kleinere Reparaturen und Wartungsarbeiten am bisherigen Kontrollmodul Sarja durch, füllten die Vorräte der Station auf und montierten die letzten Teile des Strela-Krans an der Andockschleuse.
Auch die dreistufige Protonrakete, die die Swesda in den Orbit befördern soll, steht bereits parat. Sie gehört zu einem Typ, der bisher bereits mehr als 200 Mal als Trägerrakete eingesetzt worden ist. Sie wurde 1965 für militärische Nutzlasten und für russische Raumstation entwickelt und hat auch das erste Modul der ISS, die Sarja, im November 1998 ins All transportiert. Mit einer Erfolgsquote von 98 Prozent ist die Proton heute eines der zuverlässigsten Trägersysteme überhaupt.