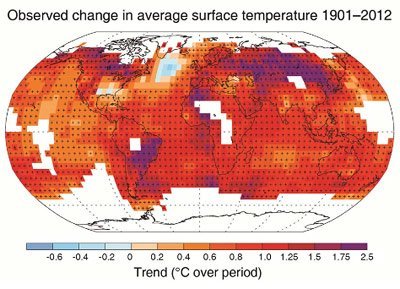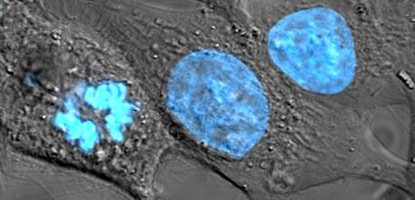Insekten haben sechs Beine und zwei Flügel – diese Erkenntnis ist nicht wirklich weltbewegend neu. Doch die scheinbar so einfache Aussage birgt schon das Hauptproblem bei der Erforschung des Insektenfluges in sich: Während bei Vögeln die Herkunft der Flügel eindeutig ist – es handelt sich um die umgebildeten Vorderbeine – herrscht bei Insekten alles andere als Klarheit darüber, was Flügel, anatomisch gesehen, überhaupt sind. Relativ sicher ist nur eines: ehemalige Beine sind es nicht. Doch was dann?
Bis heute stehen Insektenforscher hier vor einem Rätsel. Zwar gibt es einige sehr unterschiedliche und heiß diskutierte Theorien, aber beweisen lässt sich bisher keine von ihnen. Das könnte nur der Fund eines Missing Links, eines Fossils, das die Übergangsform zwischen flügellosen und geflügelten Insekten zeigt. Doch ein Beweisstück dieser Art gibt es – wenigstens bis jetzt – nicht. Die Wissenschaftler sind daher darauf angewiesen, die Entwicklung zu rekonstruieren, wie Detektive müssen sie sich ihre Anhaltspunkte dabei von den heutigen Insekten und ihren Flügeln „abgucken“. Angesichts der verwirrenden Fülle der Flügelformen allerdings keine ganz leichte Aufgabe…
Der Grundbauplan ist bei allen Insektenflügeln der gleiche: Eine dünne häutige Membran, die durch feste, flüssigkeitsgefüllte Adern stabilisiert wird und mit Gelenken am Vorderkörper des Insekts ansetzt. Doch der Variationen dieses Grundprinzips scheint es unendlich viele zu geben.
Käfer haben ihre Vorderflügel in feste, dicke Schilde umgewandelt, die den empfindlichen Hinterleib und die Hinterflügel schützen, beim Fliegen werden sie – mehr oder weniger elegant – seitlich weggespreizt, um den Hinterflügeln Platz zu schaffen.