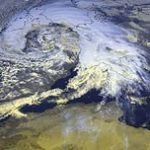Der Ausbruch des Pinatubo war gewaltig. Als der philippinische Vulkan im Juni 1991 seine Kuppe absprengte, erhob sich eine gigantische Aschewolke in den Himmel. Sie tauchte die Insel Luzon mitten am Tage in Finsternis. Auf eine Fläche von der Größe Baden-Württembergs, Bayerns und Hessens zusammen regneten Unmengen von Asche herab. Sie begrub Straßen und Gebäude unter einer teils meterhohen Schicht. Hunderte Menschen starben, Zehntausende verloren ihr Zuhause.

Die Eruption war so stark, dass Asche und Gase bis in die Stratosphäre gerissen wurden, dreimal so hoch, wie Verkehrsflugzeuge fliegen. Mehrere Stunden lang bebte der Berg. In dieser Zeit spuckte er acht Millionen Tonnen Schwefeldioxid-Gas aus. In wenigen Tagen verteilte sich das Gas mit den weiträumigen Luftströmungen in der Stratosphäre über die gesamte Nordhalbkugel. Und das führte zu einem interessanten Phänomen: Auf der Erde wurde es kühler.
Kühlender Schleier
Die Ursache dieses Kühleffekts ist schon lange bekannt. Das Schwefeldioxid reagiert in der Atmosphäre mit der Luftfeuchtigkeit zu Schwefelsäure, aus der sich kleine Schwefelsalz-Partikel bilden, sogenannte Sulfatpartikel. Diese Aerosole schweben für eine gewisse Zeit in der Luft und reflektieren einen Teil der Sonnenstrahlung, die auf die Erde trifft. Damit bewirken sie eine Abkühlung in den darunter liegenden Schichten der Atmosphäre.
Kein Wunder also, dass der Ausbruch des Pinatubo, einer der stärksten im vergangenen Jahrhundert, für Klimaforscher interessant ist. „Dieser Vulkanausbruch hat eindrücklich gezeigt, dass der Eintrag von Schwefeldioxid in die Atmosphäre einen messbaren Effekt hat“, sagt Ulrike Niemeier, Meteorologin am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Ulrike Niemeier widmet sich schon seit Jahren der Frage, wie das Schwefeldioxid und die Asche, die Vulkane ausstoßen, die Erdatmosphäre beeinflussen.