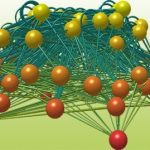Doch auch für Tiere, von denen es keine ausreichend gut erhaltenen Zellen mehr gibt, besteht Hoffnung: Wissenschaftler können heute selbst aus fragmentierten DNA-Spuren das Genom eines Lebewesens rekonstruieren. Dies ist ihnen zum Beispiel bei einem 700.000 Jahre alten Pferde-Fossil gelungen und auch von den vor einigen tausend Jahren ausgestorbenen Mammuts ist inzwischen das vollständige Erbgut bekannt.
Wie aber lassen sich diese Informationen für eine Wiederbelebung nutzen? Wie schon beim Auerochsen könnte das Genom mit dem Erbgut verwandter noch lebender Tierarten abgeglichen werden. Zellen dieser Tiere könnten dann mithilfe gentechnischer Methoden so abgeändert werden, dass sie das Genom der ausgestorbenen Spezies exprimieren und anschließend für einen Klonversuch genutzt werden – eine Rückzüchtung im Turboverfahren sozusagen.
Unterschiede im Erbgut
Forscher verfolgen diesen Ansatz etwa bei der im 19. Jahrhundert durch den Menschen ausgerotteten Wandertaube, die einst in riesigen Schwärmen durch die Lüfte Nordamerikas zog. Als Referenzgenom soll ihnen das Erbgut der eng verwandten Schuppenhalstaube dienen. Ziel ist es dabei jedoch nicht, jede einzelne Stelle zu verändern, in denen sich die beiden Genome voneinander unterscheiden.
Stattdessen wollen die Wissenschaftler herausfinden: Welche Mutationen sind wirklich entscheidend, um die charakteristischen Merkmale der Wandertaube zu erzielen? Dass diese Vorgehensweise sinnvoll ist, zeigt das Beispiel des Wollhaarmammuts: Die Abstammungslinie dieses Dickhäuters hat sich erst vor rund fünf Millionen Jahren von der der heute noch lebenden Asiatischen Elefanten getrennt – und trotzdem unterscheidet sich das Erbgut der Tiere in ein paar Millionen Positionen.