Wird ein Atomkraftwerk stillgelegt, gibt es für den weiteren Ablauf zwei Varianten. Beim sicheren Einschluss wird der komplette Reaktor zunächst mehrere Jahrzehnte lang eingeschlossen. Erst danach beginnt der Rückbau. Beim direkten Rückbau dagegen wird unmittelbar nach Genehmigung der Stilllegung mit dem Abriss und der Entsorgung der Anlage begonnen.

Einschluss: Für Jahrzehnte weggesperrt
Auf den ersten Blick scheint der sichere Einschluss durchaus Vorteile zu haben. So zerfällt während der Wartezeit schon ein Teil der kurzlebigen Radionuklide wie beispielsweise Cobalt-60. Dadurch wird die Kontamination zumindest teilweise schwächer. Hinzu kommt, dass es bisher kein Endlager für hochradioaktiven Atommüll gibt – weder in Deutschland noch woanders auf der Welt. Der stark strahlende Abfall aus den stillgelegten Atomkraftwerken muss daher in Zwischenlagern aufbewahrt werden. Doch weder die Castorbehälter noch die oberirdischen Lagerhallen bieten auf Dauer eine ausreichende Sicherheit.
Unter anderem deshalb fordern auch einige Atomkraftgegner den sicheren Einschluss, beispielsweise beim Kraftwerk Grafenrheinfeld in Bayern. Sie argumentieren unter anderem damit, dass die Castoren mit dem Kernbrennstoff im Reaktorgebäude sicherer gelagert werden können als in den Hallen der Zwischenlager.
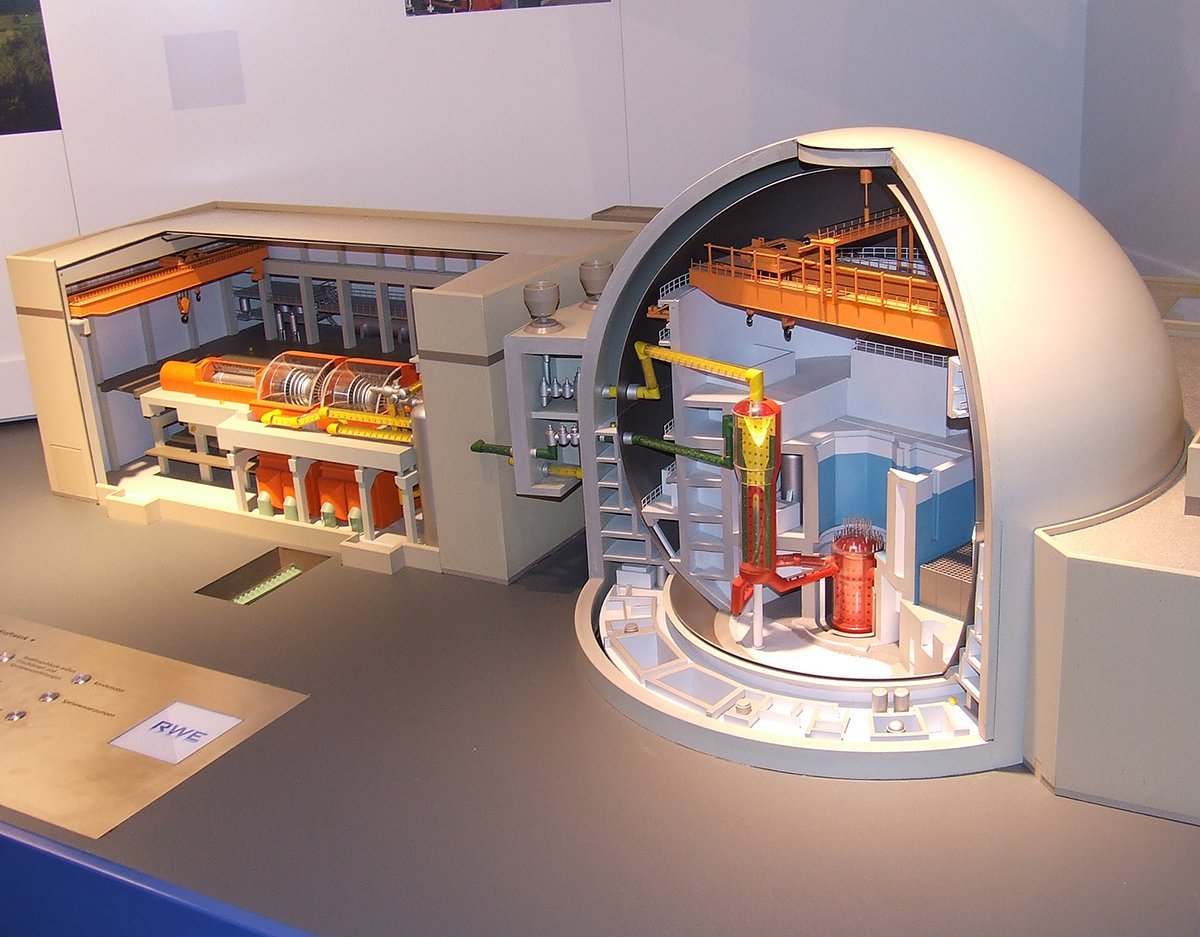
Aufschub mit Nachteilen
Doch der sichere Einschluss hat gravierende Nachteile. Einer der schwerwiegendsten ist der Verlust des Knowhows durch das Fachpersonal der im Atomkraftwerk Beschäftigten. „In 50 Jahren wäre keine Person mehr vorhanden, die die Anlage und ihre Betriebsgeschichte noch aus eigener Anschauung kennt“, erklärt dazu das Öko-Institut. „Auf vorhandene Pläne allein ist aus Erfahrung aber kein Verlass, da die im Detail oft nicht mit der tatsächlich errichteten Anlage übereinstimmen.“












