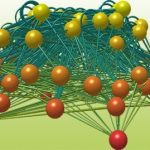Doch selbst, wenn es eines Tages klappt: Keiner der diskutierten Ansätze wird die ausgestorbenen Spezies in exakt der Form wiederholen können, wie sie einst auf der Erde lebten. Nicht nur bei der Rückzüchtung, auch beim Klonen nach der Dolly-Methode wird zum Beispiel keine hundertprozentige genetische Übereinstimmung mit dem Ausgangstier erreicht. Denn die Mitochondrien der fremden Eizelle haben ihr eigenes Genom und geben diese DNA an den Nachwuchs weiter.
Weitaus entscheidender könnte jedoch ein weiterer Aspekt sein: Viele wiederbelebte Arten würden sich heute einer ganz anderen Umgebung ausgesetzt sehen als sie ursprünglich kannten. Das fängt bei der Leihmutter an und geht über den Lebensraum bis hin zur Ernährung. All diese Faktoren beeinflussen die Entwicklung der Tiere, die sich somit zwangsläufig verändern.
Ökosysteme im Gleichgewicht
Doch ist das Ziel der „De-extinction“ damit verfehlt? Nicht unbedingt, sagen einige Forscher. Denn es braucht keine exakte Replikation, um die mit diesem Ansatz verfolgten Absichten zu erreichen. Schließlich geht es oftmals darum, wieder eine Schlüsselart in ein aus dem Gleichgewicht geratenes Ökosystem einzuführen. So soll der im Tauros-Programm gezüchtete, neue Auerochse künftig jene Landstriche bevölkern, die früher der Ur durchstreifte. Und auch das wiederbelebte Mammut könnte in Sibirien eine offene ökologische Nische füllen.
„Der neue Auerochse und das neue Mammut werden zwar nicht genetisch identisch mit dem ausgestorbenen Auerochsen und dem ausgestorbenen Mammut sein“, konstatiert die Evolutionsbiologin Beth Shapiro. „Doch es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass sie nicht grasen, Nährstoffe verwerten und verteilen und auf diese Weise zu einem vielfältigen, gesunden Ökosystem beitragen – so wie es einst Auerochse und Mammut getan haben.“