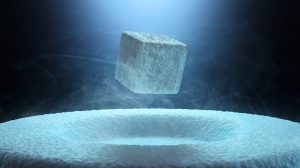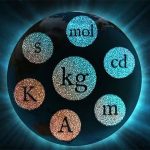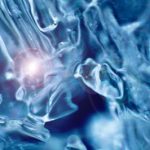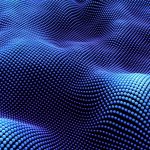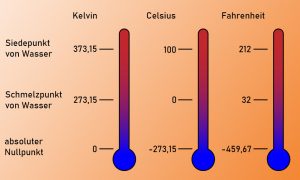Die Temperatur spielt für die Menschheit schon seit jeher eine große Rolle. Über Jahrhunderte hinweg beschäftigten sich Wissenschaftler deshalb mit der Frage, wie sich ein konkretes Maß für die Temperatur festlegen und bestimmen lässt. Wann und wo das erste Instrument gebaut wurde, das als Thermometer bezeichnet werden kann, ist heute nur schwer zu rekonstruieren –es war eher ein schleichender Prozess als ein einzelner Durchbruch.
Die ersten wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Thermodynamik werden Heron von Alexandria zugeschrieben. Der Grieche baute zwar kein Gerät zur direkten Temperaturbestimmung, erkannte aber bereits im ersten Jahrhundert nach Christus, dass es einen Zusammenhang zwischen Temperatur und Volumen geben muss. So entwarf er beispielsweise den Heronsball, eine lose aufgehängte Kugel mit seitlichen Ventilen, die durch im Inneren erhitzten und austretenden Wasserdampf zum Rotieren gebracht wird.

Thermoskope: Nah dran, aber nicht genug
Die nächsten dokumentierten Experimente, die sich mit dem Zusammenhang zwischen Temperatur und Volumen beschäftigten, ließen fast eineinhalb Jahrtausende auf sich warten. Im 16. und 17. Jahrhundert arbeiteten einige Gelehrte parallel an Geräten zur Temperaturbestimmung. So baute Galileo Galilei um das Jahr 1593 eines der ersten Thermoskope. Als solche bezeichnet man eine luftgefüllte Glasröhre, die am unteren Ende im Wasser steht. Wenn die Temperatur des Wassers steigt, dehnt es sich aus und der Pegel in der Glasröhre hebt sich.
Da Thermoskope im Gegensatz zu Thermometern keine Skala besitzen und zu diesem Zeitpunkt noch kein einheitliches Maß eingeführt wurde, eigneten sie sich allerdings wenig zur konkreten Temperaturbestimmung. Ein weiteres Problem der offenen Thermoskope war, dass sie vom Luftdruck ihrer Umgebung abhängig waren. Diesem nahm sich unter anderem Ferdinand II. aus dem Hause Medici an. Als einer der ersten nutzte er um das Jahr 1654 eine versiegelte Glasröhre als Thermoskop.