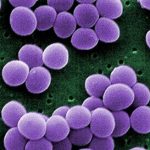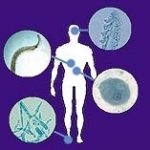Flecken in Bakterienkulturen brachten den französischen Bakteriologen Félix d’Hérelle erstmals auf die Spur der Phagen: Bei Untersuchungen mit an Ruhr erkrankten Patienten bemerkte er, dass die von ihm im Labor kultivierten Erreger an bestimmten Stellen nicht richtig wuchsen und nach und nach wie von Geisterhand verschwanden. Ähnliches hatte einige Zeit zuvor bereits sein britischer Kollege Frederick Twort entdeckt. Dieser untersuchte das rätselhafte Phänomen allerdings nicht weiter – im Gegensatz zu d’Hérelle.
Ihn führten weitere Experimente schließlich zu der Vermutung, dass für das Verschwinden der Kulturen „unsichtbare Mikroben“ verantwortlich sein mussten – Mikroorganismen, die die Ruhr auslösenden Bakterien gewissermaßen auffraßen. Diese Ergebnisse präsentierte d’Hérelle im September 1917 auf einem wissenschaftlichen Kongress und prägte damals den Begriff Bakteriophage: Bakterienfresser.
Erste Erfolge
Das Potenzial seiner Entdeckung erkannte d’Hérelle sofort: Wenn es Phagen gab, die Bakterien fraßen, konnten diese dann nicht im Kampf gegen bakterielle Infektionen eingesetzt werden? Seine Versuche, diese Hypothese zu bestätigen, führten schon bald zu einem ersten Erfolg. Im Frühjahr 1919 isolierte d’Hérelle Phagen aus Hühnerkot und behandelte damit an Hühnertyphus erkranktes Geflügel.
Dieses vielversprechende Ergebnis veranlasste den Forscher dazu, ähnliche Therapiemethoden an menschlichen Patienten zu erproben: Im August 1919 behandelte er erstmals einen Ruhr-Patienten mit Phagen-Lösungen und heilte ihn. Auch gegen die Pest und Cholera setzte d’Hérelle die Phagentherapie anschließend erfolgreich ein. Doch sein Behandlungsansatz sollte bald in Vergessenheit geraten – zumindest in der westlichen Welt.