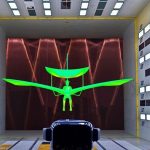Martina Meyer ist gerade am Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel gelandet. Sie muss direkt weiter in die Innenstadt. Martina schaut auf die Uhr: Mit U- oder S-Bahn benötigt sie für die zehn Kilometer zum Kongresszentrum knapp vierzig Minuten. Mit Taxi oder Mietwagen dauert es geringfügig länger, aber nur, wenn sie gut durchkommt – angesichts der momentanen Rush Hour fraglich. Doch seit Kurzem gibt eine praktische Alternative: das Lufttaxi …
Zugegeben, dieses Szenario ist eine Zukunftsvision. In der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts könnte sie jedoch Realität werden. An ihrer Umsetzung arbeiten beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) insgesamt zehn Forschungsinstitute unter Leitung des Instituts für Flugführung. Das inzwischen abgeschlossene Projekt, in dem das DLR mit der NASA und dem Bauhaus Luftfahrt zusammenarbeitete, heißt HorizonUAM (Urban Air Mobility, städtischer Luftverkehr).
Vom Vertidrom zum Vertistop
Martina macht sich auf den Weg zum benachbarten Vertidrom. Von hier aus schrauben sich die elektrisch angetriebenen Lufttaxis in die Höhe. Sie sind in etwa so groß wie ein Kompaktvan und bieten Platz für vier Personen. Mit drei weiteren Fahrgästen, die dasselbe Ziel haben, checkt Martina ein und steigt zu. Ein Pilot oder eine Pilotin ist nicht an Bord, der Flug wird vollautomatisch durchgeführt.
„Vertidrom“ ist im Projekt HorizonUAM der Sammelbegriff für Start- und Landeflächen von Lufttaxis. Darunter fallen sowohl Vertiports als auch Vertistops. Ein Vertiport ist ein Set von Landepads, das neben Ladestationen auch Kapazitäten für Wartung und Reparaturen besitzt. Hier werden Ersatzteile und Werkzeug vorrätig gehalten und Personen kümmern sich um die Einsatzfähigkeit der Flugtaxis. Vertistops verfügen lediglich über ein Landepad sowie minimale Infrastruktur zur Passagierabfertigung, Wetterüberwachung, Kommunikation und Navigation.