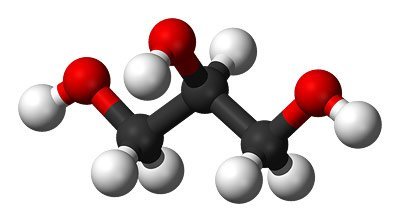Für Frösche, Insekten und andere wechselwarme Tiere ist die kalte Jahreszeit eine ernsthafte Bedrohung: Im Gegensatz zu Säugern und Vögeln können sie ihre Körpertemeratur nicht auf einem Sollwert halten, sondern sind mehr oder weniger von der Umgebungstemperatur abhängig.
Wenn es im Herbst und Winter anfängt zu frieren, können diese Tiere nur dann überleben, wenn sie sich vor dem tödlichen Gefrieren schützen. Gerade Insekten und andere Gliedertiere scheinen durch ihre geringe Größe im Winter besonders benachteiligt zu sein: Mit einer im Verhältnis zu ihrem Körpervolumen großen Oberfläche bieten sie der Kälte mehr Angriffsfläche. Aber für viele Arten liegt gerade in ihrer Kleinheit der Hauptschutz gegen ein Gefrieren.
Supercooling: Wehret der Kristallisation
Wissenschaftler haben festgestellt, dass sehr kleine Flüssigkeitsvolumen und extrem reines Wasser erst erheblich später als 0°C zu Eis erstarren. Fünf Mikroliter Leitungswasser können zum Beispiel bis auf –18°C runtergekühlt werden, ohne daß es gefriert. Das funktioniert deshalb, weil die Bildung von Eis immer an sogenannten Kristallisationskernen beginnt. Für uns unsichtbar lagern sich die Wassermoleküle an Staubpartikeln, Molekülen oder Oberflächen an und ordnen sich zum Eiskristallgitter an. Je ähnlicher ein solcher Auslöser der Kristallstruktur des Eises ist, desto wirksamer ist er als Kristallisationskern. In sehr kleinen Wassermengen oder sehr reinem Wasser fehlen diese Kerne, so dass auch bei Temperaturen unter dem eigentlichen Gefrierpunkt keine Eiskristalle entstehen.
Dieses Phänomen, „supercooling“ oder „Unterkühlen“ genannt, macht sich zum Beispiel die bei uns heimische Getreideblattlaus zunutze. Sie übersteht ohne zu Gefrieren Temperaturen bis –23°C – völlig ohne Frostschutzmittel. Allerdings hat sie auch gegenüber vielen anderen Insekten einen entscheidenden Vorteil: als Pflanzensaftsauger enthält ihre Nahrung kaum Kristallisationskerne.