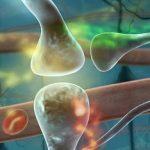Besonders fatal wirkt sich Stress ausgerechnet bei denjenigen aus, die sich am wenigsten dagegen wehren können: den Kindern. Schon im Mutterleib bekommen sie von den Botenstoffen, die durch den Körper der Mutter fluten, einiges mit. Hat die Mutter Sorgen und Stress, wird auch das sensible System der Ungeborenen mit Cortisol und anderen Stresshormonen überschwemmt – und dies ausrechnet in einer Zeit, in der sich das kindliche Gehirn beginnt zu entwickeln.
{1l}
Hormoncocktail über die Plazenta
Bereits 2011 entdeckten Forscher erste Hinweise auf solche pränatalen Einflüsse: In einer Studie an 75.000 schwangeren Frauen in Dänemark zeigte sich, dass die Plazenta bei Müttern, die während der Schwangerschaft Stress ausgesetzt waren, stärker wuchs als bei ungestressten Schwangeren. Mit anderen Worten: Die entscheidende Schaltstelle zwischen kindlichem und mütterlichem Organismus ist bei gestressten Müttern verändert. Da das Kind sämtliche Nährstoffe, Blut und Botenstoffe über die Plazenta bekommt, lag damit nahe, dass Stress auch sie Versorgung des Kindes beeinflusst.
Wenig später wies eine andere Forschergruppe nach, dass eine Depression der Mutter während der Schwangerschaft die spätere Sprachentwicklung ihres Kindes verzögert. Waren die Ungeborenen im Mutterleib dem für die Depression typischen Hormoncocktail ausgesetzt, reagierten sie im Durchschnitt erst vier Monate später auf typische Laute ihrer Muttersprache als Gleichaltrige. Dieser Effekt trat aber nicht auf, wenn die Mütter Medikamente gegen ihre Depression eingenommen hatten. Diese sogenannten Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer bremsen den Abbau des stimmungsaufhellend wirkenden Hormons Serotonin und lindern so die Symptome der Depression. Dieser Effekt scheint auch bei dem Ungeborenen Spuren zu hinterlassen.
Prägung im ersten Lebensjahr
Noch deutlicher aber wird die Lage, wenn Kinder nach der Geburt, in der frühen Kindheit, Stress ausgesetzt sind. Auch wenn Säuglinge im ersten Lebensjahr noch nicht sprechen können, bekommen sie vor allem soziale Signale aus ihrem Umfeld sehr genau mit. Ist die Mutter genervt und überfordert oder streiten sich die Eltern ständig, läuft auch beim Kleinkind die körpereigene Stress-Maschinerie auf Hochtouren. Als Folge steigt auch bei ihm der Pegel des Stresshormons Cortisol im Blut.
Wie Forscher der University of Wisconsin-Madison 2012 in einer Studie herausfanden, wirkt sich dieser Stress im ersten Lebensjahr zumindest bei Mädchen noch bis ins Grundschulalter aus: Die Kinder hatten selbst mit viereinhalb Jahren noch höhere Cortisol-Spiegel im Blut als Gleichaltrige. Damit aber war das Thema noch nicht erledigt. Denn die US-Forscher untersuchten die Kinder noch ein weiteres Mal. Als diese 18 Jahre alt waren unterzogen sie sie sowohl psychologischen Tests als auch einem Hirnscan. Bei diesem verglichen sie die Ruheaktivität von zwei Hirnarealen, den Mandelkernen – dem Gefühlszentrum des Gehirns – und dem präfrontalen Cortex, einer Hirnregion, die für die Kontrolle von Impulsen und Emotionen zuständig ist.
Verbindung gestört
Das Ergebnis: Bei den Mädchen, die als Säuglinge häufig Stress ausgesetzt waren und auch als Schulkinder noch erhöhte Cortisolwerte hatten, feuerten die beiden Hirnareale weniger synchron. Sie waren demnach weniger eng miteinander verknüpft als bei Gleichaltrigen, die keine so ausgeprägten frühkindlichen Stresserfahrungen hatten. Gleichzeitig ergaben die psychologischen Tests, dass diese Mädchen auch vermehrt unter Depressionen und Ängsten litten.
Interessanterweise war die Veränderung im Gehirn auch bei den Mädchen nachweisbar, die zum Zeitpunkt des Hirnscans keinerlei Anzeichen für akuten Stress aufwiesen. Nach Ansicht der Forscher zeigt dies, dass Stress seine Wirkung auf das Gehirn vor allem in der frühen Kindheit entfaltet, dann, wenn das Denkorgan noch mitten in der Entwicklung steckt und entscheidende Verknüpfungen gebildet werden. „Unsere Ergebnisse zeigen eine überzeugende Entwicklungskette von frühkindlichem Stress über die Cortisol-Spiegel in der Kindheit bis hin zu Veränderungen in der Gehirnfunktion bei den jugendlichen Frauen“, konstatieren Cory Burghy und ihre Kollegen von der University of Wisconsin-Madison.
Nadja Podbregar
Stand: 25.01.2013